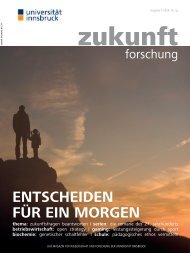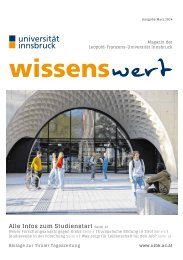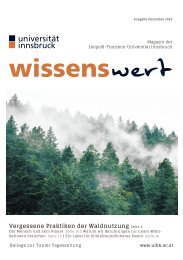Zukunft Forschung 02/2023
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
RECHTSWISSENSCHAFT<br />
MATTHIAS KETTEMANN: „Wir hinterfragen<br />
demokratische Strukturen auf<br />
produktive Art und Weise.“<br />
REGROUP steht für Rebuilding governance<br />
and resilience out of the pandemic<br />
– übersetzt in etwa „Wiederaufbau von<br />
Regierungsfähigkeit und Resilienz nach<br />
der Pandemie“. Das über das Programm<br />
Horizon Europe geförderte EU-Projekt<br />
vereint unter der Führung der Rijksuniversiteit<br />
Groningen (NL) 13 Partner aus elf<br />
Ländern, darunter das Institut für Theorie<br />
und <strong>Zukunft</strong> des Rechts an der Universität<br />
Inns bruck. Die Projektdauer von<br />
REGROUP beträgt drei Jahre, Projektstart<br />
war im September 2<strong>02</strong>2. Die gesamte<br />
Fördersumme für REGROUP beläuft sich<br />
auf rund drei Millionen Euro.<br />
Kettemann und seine Projektmitarbeiterin<br />
Caroline Böck konzentrieren sich in<br />
ihrem Arbeitspaket auf die Nutzung von<br />
digitalen Tools und Plattformen.<br />
„Der erste Teil von REGROUP war eine<br />
Art Bestandsaufnahme in mehreren Ländern“,<br />
berichtet Caroline Böck. Welche<br />
(verfassungs-)rechtlichen Maßnahmen<br />
wurden getroffen, wie kam es zu Entscheidungen,<br />
gab es Machtverschiebungen<br />
zwischen Regierung und Parlament? Dabei<br />
zeigte sich, so Böck, dass Parlamente<br />
aufgrund von Ausgangs- oder Versammlungsbestimmungen<br />
zeitweise gar nicht<br />
arbeitsfähig waren. „Online-Plenarsitzungen<br />
oder -Ausschüsse sind in den Verfassungen<br />
aber nicht vorgesehen“, erläutert<br />
Böck: „Im Fall einer erneuten Gesundheitskrise<br />
mit Ansteckungsgefahr wäre<br />
daher eine juristisch sattelfeste Adaption<br />
notwendig.“ Ein „digitales Update für bestehendes<br />
Recht“ nennt Kettemann daher<br />
einen ersten Schritt, der sicherstellen soll,<br />
dass zukünftige Rechtsetzungsprozesse<br />
digitaler und somit auch resilienter sind.<br />
In einem nächsten Schritt soll bei Entscheidungsfindungen<br />
die Rückbindung an die<br />
Gesellschaft verbessert werden.<br />
„Zu Beginn der Pandemie<br />
waren viele Parlamente gar<br />
nicht arbeitsfähig. Online-<br />
Plenarsitzungen oder Online-Ausschüsse<br />
sind in den<br />
Verfassungen nicht vorgesehen.“<br />
Caroline Böck, Institut für Theorie und <strong>Zukunft</strong> des Rechts<br />
Innovationspotenziale<br />
Neben der Analyse und dem Vergleich<br />
von konkreten Maßnahmen und Entscheidungsfindungen<br />
setzt man bei<br />
REGROUP daher auch auf sogenannte<br />
Mini-Publics, Versammlungen von 20<br />
bis 100 per Los ausgewählten Menschen,<br />
die, erklärt Kettemann, „über politische<br />
Sachverhalte informiert werden, gemeinsam<br />
darüber diskutieren, entscheiden<br />
und die Ergebnisse der Politik als Handlungsempfehlungen<br />
übergeben“. Im Fall<br />
von REGROUP wurde zum Beispiel in<br />
Mini-Publics in Paris, Hamburg, Utrecht,<br />
Florenz und Krakau sowie in einem<br />
transnationalen „Format“ über die Auswirkungen<br />
der COVID-19-Krise und den<br />
Einfluss von Fake News auf das politische<br />
Vertrauen diskutiert. Ziel waren Empfehlungen,<br />
wie Governance und politisches<br />
Vertrauen nach einer durch Fake News<br />
geprägten Pandemie effektiv und demokratisch<br />
verbessert werden können.<br />
„Mini-Publics – ob im echten oder virtuellen<br />
Raum – sind eine Art Demokratielabor,<br />
die es ermöglichen, spannende<br />
Fragen zu stellen“, sagt Kettemann.<br />
Ähnlich interessant sei das Modell der<br />
Beiräte, mit dem in mehreren Ländern –<br />
in Österreich etwa mit dem Klimabeirat<br />
– experimentiert wird, das aber auch auf<br />
digitalen Plattformen wie z. B. mit dem<br />
Oversight Board bei Facebook Anwendung<br />
findet. „Es gibt unterschiedliche<br />
Innovationswege für demokratische Prozesse“,<br />
sind sich Böck und Kettemann einig.<br />
„Unser heutiges Verständnis von repräsentativer<br />
Demokratie beruht auf Annahmen,<br />
die nicht mehr zutreffen“, sind<br />
die Forscher:innen überzeugt. Im Gegensatz<br />
zu früher, als etwa „Abgeordnete in<br />
der weit entfernten Hauptstadt nur mit<br />
großem Zeitaufwand mit den Wähler:innen<br />
zu Hause kommunizieren konnten,<br />
ist heute eine Kommunikation in Echtzeit<br />
möglich.“ Man müsse nur überlegen,<br />
wie. Demokratie-Apps oder die Möglichkeit,<br />
via Smartphone an Entscheidungen<br />
teilzuhaben, wären Modelle, die geprüft<br />
werden. Die Ergebnisse sollen als Policy<br />
Recommendations der EU und ihren Mitgliedstaaten<br />
helfen, digitale Werkzeuge<br />
und Strategien zu entwickeln, um zukünftige<br />
Risiken zu vermeiden bzw. zu<br />
mindern und die gesellschaftliche und<br />
demokratische Widerstandsfähigkeit im<br />
Post-Pandemie-Europa zu verbessern.<br />
„Wir hinterfragen demokratische<br />
Strukturen auf produktive Art und Weise.<br />
Wir haben heute so viele digitale<br />
Möglichkeiten der Kommunikation, mit<br />
denen die demokratische Rückbindung<br />
optimiert werden könnte“, halten Böck<br />
und Kettemann fest. Als Forscher:innen<br />
am 2019 gegründeten Institut für Theorie<br />
und <strong>Zukunft</strong> des Rechts sehen sie es als<br />
ihre Aufgabe, „heute an der Art und Weise,<br />
wie wir Entscheidungen treffen, zu<br />
arbeiten, damit auch nächste Generationen<br />
gute Entscheidungen treffen können<br />
und sich nicht von der Demokratie abwenden.“<br />
ah<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 43