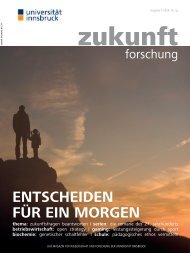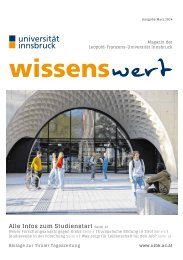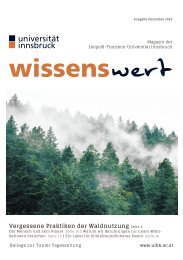Zukunft Forschung 02/2023
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KURZMELDUNGEN<br />
FRÜHWARNSYSTEM<br />
FÜRS KLIMA<br />
Gletscherwände in Grönland geben Hinweise<br />
auf den Wandel des arktischen Klimas.<br />
Es gibt nur wenige Orte weltweit, an<br />
denen Gletscher an Land in Form<br />
eines Eiskliffs enden. An Land müssen<br />
ganz bestimmte Bedingungen existieren,<br />
um langfristig stabile Eismauern hervorzubringen.<br />
Der überwiegende Teil<br />
läuft in flacher werdenden Gletscherzungen<br />
aus, die beispielsweise auch für die<br />
Alpen typisch sind. Nur am Gipfel des<br />
Kilimandscharo, in den Trockentälern der<br />
Antarktis sowie in Nordwestgrönland<br />
und der kanadischen Arktis gibt es diese<br />
raren Eiskliffe an Land. Die Gletscherforscher<br />
Rainer Prinz von der Universität<br />
Inns bruck und Jakob Abermann von der<br />
Universität Graz wollen in einem vom<br />
Wissenschaftsfonds FWF finanzierten und<br />
vor Kurzem gestarteten Projekt die Eiswände<br />
in Grönland näher untersuchen.<br />
Ihr Ziel sind die bis zu 25 Meter hohen<br />
Red Rock Icecliffs, die Teil der Nunatarssuaq-Eiskappe<br />
im nördlichen Landesteil<br />
Avanersuaq sind. Die Wissenschaftler<br />
wollen die Formationen, die besonders<br />
sensibel auf die Veränderung von Umweltfaktoren<br />
reagieren, als Instrument benutzen,<br />
um das lokale grönländische Klima<br />
im Kontext der globalen Erderwärmung<br />
besser zu verstehen. „Veränderte<br />
Klimasignale wirken sich sehr schnell auf<br />
das Gleichgewicht der Gletscher aus“, erklärt<br />
Prinz. „Wenn wir verstehen, in welcher<br />
Weise das Eis auf Veränderungen der<br />
Umweltfaktoren reagiert, können wir<br />
Rückschlüsse auf eine aktuelle Entwicklung<br />
des lokalen Klimas ziehen.“<br />
WECHSELWIRKENDE<br />
QUASITEILCHEN<br />
Bewegt sich ein Elektron durch einen Festkörper,<br />
erzeugt es aufgrund seiner elektrischen<br />
Ladung in der Umgebung eine Polarisation.<br />
Der russische Physiker Lew etcLandau<br />
hat in seinen theoretischen Überlegungen<br />
die Beschreibung solcher Teilchen um deren<br />
Wechselwirkung mit der Umgebung erweitert<br />
und von Quasiteilchen gesprochen. Vor über<br />
zehn Jahren war es dem Team um Rudolf<br />
Grimm vom Institut für Experimentalphysik<br />
der Universität Inns bruck und vom Institut<br />
für Quantenoptik und Quanteninformation<br />
(IQQOI) der Österreichischen Akademie der<br />
Wissenschaften erstmals gelungen, solche<br />
Quasiteilchen in einem Quantengas sowohl<br />
bei attraktiver als auch repulsiver Wechselwirkung<br />
mit der Umgebung zu erzeugen.<br />
Dazu nutzen die Wissenschaftler:innen ein<br />
ultrakaltes Quantengas aus Lithium- und<br />
Kaliumatomen in einer Vakuumkammer. Mit<br />
Hilfe von magnetischen Feldern kontrollieren<br />
sie die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen<br />
und mit Hochfrequenzpulsen drängen<br />
sie die Kaliumatome in einen Zustand, in dem<br />
diese die sie umgebenden Lithiumatome<br />
anziehen oder abstoßen. So simulieren die<br />
Forscher:innen einen komplexen Zustand,<br />
wie er im Festkörper durch ein freies Elektron<br />
erzeugt wird. Nun konnten die Forscher:innen<br />
um Grimm in dem Quantengas mehrere<br />
solche Quasiteilchen gleichzeitig erzeugen<br />
und deren Wechselwirkung untereinander<br />
beobachten.<br />
BIOMARKER FÜR ALTERSBEDINGTE KRANKHEITEN<br />
Objektive biologische Messwerte können helfen, den Alterungsprozess in individuellen Personen<br />
zu messen und das Risiko für altersbedingte Erkrankungen zu identifizieren. Da sich das Altern<br />
jedoch aus vielen verschiedenen Prozessen zusammensetzt, gab es bislang keine Übereinstimmung<br />
unter Expert:innen, wie solche Biomarker am besten zur Anwendung kommen könnten. Ein internationales<br />
Team um Chiara Herzog (im Bild) hat nun weltweit bestehende Rahmenstrukturen zur<br />
Biomarker-Erfassung systematisch angepasst und erweitert, um „Biomarker des Alterns“ und deren<br />
klinische Anwendungen zu definieren. Publiziert haben sie diese in der renommierten Fachzeitschrift<br />
Cell. „Die Alternsforschung hat das Potenzial, uns länger und gesünder leben zu lassen“,<br />
sagt Herzog. „Wir haben in dieser Arbeit erstmals eine Übereinstimmung zwischen internationalen<br />
Expert:innen herbeigeführt, wie wir Biomarker des Alterns untersuchen können.“<br />
Fotos: Rainer Prinz (1), Harald Ritsch(1), Patrick Saringer (1)<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 41