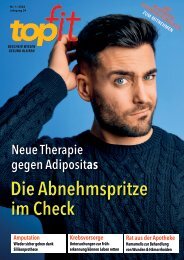TOPFIT Herbst 2023
Bescheid wissen - gesund leben
Bescheid wissen - gesund leben
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diagnose & Therapie<br />
13<br />
Illu oben: © isn5000 / 123rf.com<br />
ben und Organen anzusiedeln. Einer Theorie<br />
zufolge kommt es zu übermäßigen Kontraktionen<br />
der Gebärmuttermuskulatur und damit zu<br />
Verletzungen in tieferen Schleimhautschichten.<br />
Dies führt dann womöglich dazu, dass Zellen<br />
aus diesen Schichten im Sinne eines Rückflusses<br />
von Menstruationsblut (retrograde Menstruation)<br />
über die Eileiter in den Bauchraum gelangt<br />
und sich dort ansiedeln. Aber auch Zellumwandlungen<br />
könnten eine Rolle spielen.<br />
Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass<br />
Zellen des Bauchfells die Fähigkeit besitzen, sich<br />
eigenständig in Gebärmutterschleimhautzellen<br />
umzuwandeln. Es gibt noch einige weitere Theorien<br />
zur Entwicklung einer Endometriose; abschließend<br />
geklärt sind die Entstehungsmechanismen<br />
bislang nicht.<br />
Geschlechtshormone als Taktgeber<br />
Fest steht jedoch, dass die Endometrioseherde<br />
denselben hormonellen Einflüssen unterworfen<br />
sind wie die Gebärmutterschleimhaut: Unter<br />
dem Einfluss der Geschlechtshormone wachsen<br />
sie zu Beginn des Monatszyklus genauso wie<br />
die Schleimhaut der Gebärmutter – und bei jeder<br />
Menstruation bluten sie mit. Problematisch<br />
kann es werden, wenn das Blut nicht abfließen<br />
kann. Dann können große blutgefüllte Zysten<br />
entstehen. »Hinzu kommen weitere Komplikationen<br />
wie lokale Entzündungsreaktionen sowie<br />
eine daraus resultierende Überempfindlichkeit<br />
von schmerzübermittelnden Nerven. Ebenso<br />
kann es zu einer Neueinsprossung derartiger<br />
Nerven kommen. Zudem führt der wiederkehrende<br />
Schmerz zu Lern- und Anpassungsprozessen<br />
im Gehirn, dies spielt in der Schmerzchronifizierung<br />
eine wichtige Rolle«, erklärt<br />
Prof. Kolben.<br />
Auffällige Symptome können bereits mit der<br />
ersten Monatsblutung beginnen. Häufiger treten<br />
sie jedoch im Alter zwischen 20 und 30 Jahren<br />
auf – und sie werden dann zu ständigen Begleitern,<br />
die nicht mehr von selbst wieder ver-<br />
Spezialsprechstunde<br />
Das Endometriosezentrum des<br />
LMU Klinikums bietet jeden<br />
Montag und Mittwoch von 8.30<br />
Uhr bis 14.30 Uhr eine Endometriosesprechstunde<br />
an. Interessierte<br />
Frauen können sich entweder<br />
von ihrer Frauenärztin<br />
oder ihrem Frauenarzt überweisen<br />
lassen oder selbst einen Termin<br />
ausmachen.<br />
Nähere Infos unter<br />
www.lmu-klinikum.de<br />
schwinden. Erst mit Beginn der Wechseljahre<br />
tritt meist eine deutliche Besserung ein. »Aber<br />
es kommt auch vor, dass Frauen jenseits der<br />
Menopause noch mit Symptomen zu kämpfen<br />
haben«, weiß Prof. Kolben.<br />
Weshalb Frauen überhaupt an Endometriose<br />
erkranken, ist unklar. Obwohl die Krankheit<br />
schon seit über hundert Jahren bekannt ist<br />
und so viele Frauen betroffen sind, weiß man<br />
bislang nur wenig über die Ursachen. Auffällig<br />
ist, dass Töchter von Endometriosepatientinnen<br />
deutlich häufiger erkranken als Töchter<br />
von gesunden Frauen. Doch müssen, so die<br />
einhellige Expertenmeinung, noch andere Faktoren<br />
hinzukommen, damit es zum Ausbruch<br />
der Erkrankung kommt. »Zu verstehen, wie<br />
Endometriose entsteht, ist letztlich die grundsätzliche<br />
Voraussetzung, eine kausale Therapie<br />
zu entwickeln«, sagt Professor Kolben. Deshalb<br />
hat die Bundesregierung gerade fünf Millionen<br />
Euro zur Erforschung der Erkrankung bereitgestellt.<br />
Bis erste Ergebnisse vorliegen, wird es<br />
jedoch noch eine Weile dauern.<br />
Schwierige Diagnose<br />
Leicht zu diagnostizieren ist Endometriose<br />
nicht, gerade in frühen Stadien basiert die Diagnosestellung<br />
vor allem auf der entsprechenden<br />
Krankengeschichte. Ein erfahrener Arzt oder<br />
eine erfahrene Ärztin kann jedoch durch eine<br />
Tast- und Ultraschalluntersuchung insbesondere<br />
tief infiltrierende Endometrioseherde relativ<br />
gut identifizieren. Die abschließende definitive<br />
Diagnose kann letztlich nur mit einer<br />
Bauchspiegelung gesichert werden. »Die Laparoskopie<br />
dient dann meist nicht nur der Diagnostik,<br />
sondern auch gleich der Therapie«, erklärt<br />
Prof. Kolben.<br />
Ganzheitlicher Ansatz in der Therapie<br />
Auch Medikamente zur Schmerzlinderung<br />
oder die Gabe von Hormonen (wie Gestagene,<br />
GnRH-Analoga), die die Aktivität der Endometriose-Herde<br />
unterdrücken, sind Behandlungsoptionen.<br />
Nicht alle Frauen sprechen jedoch auf<br />
diese Maßnahmen an. Zudem sind Nebenwirkungen<br />
häufig. Oft greift etwa eine hormonelle<br />
Therapie tief in den natürlichen Hormonhaushalt<br />
ein, sodass dann z. B. keine Menstruation<br />
mehr stattfindet. Schmerzmittel können wiederum<br />
Leber und Nieren schädigen, insbesondere<br />
wenn sie regelmäßig eingenommen werden. Die<br />
Behandlung von Patientinnen, die unter Endometriose<br />
leiden, sollte deshalb als ganzheitlicher<br />
Ansatz verstanden werden. Hierbei müssen die<br />
Wünsche und Bedürfnisse sowie Lebensumstände<br />
der Patientinnen in das Therapiekonzept<br />
mit einfließen. »In unserem Endometriose-Zentrum<br />
der LMU Frauenklinik, das auf der<br />
höchsten Stufe zertifiziert ist, gewährleisten wir<br />
dies in enger Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern<br />
der verschiedenen anderen<br />
Fachdisziplinen«, sagt Prof. Kolben. »Außerdem<br />
arbeiten wir im Rahmen zahlreicher Forschungsprojekte<br />
aktiv an der Verbesserung der<br />
Diagnostik und Therapie auf dem Gebiet der<br />
Endometriose« – so sei das Team stets auf dem<br />
neuesten Stand, um allen Patientinnen eine optimale<br />
Beratung und Behandlung an der LMU<br />
Frauenklinik anbieten zu können.<br />
Zur Person<br />
Prof. Dr. med. Thomas Kolben<br />
Oberarzt der Klinik und Poliklinik<br />
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
LMU Klinikum<br />
Zentrumskoordinator des<br />
Endometriose-Zentrums<br />
Campus Großhadern<br />
Tel. 089/4400-76800<br />
www.lmu-klinikum.de<br />
Foto: © LMU Klinikum München<br />
<strong>TOPFIT</strong> 3 / <strong>2023</strong>