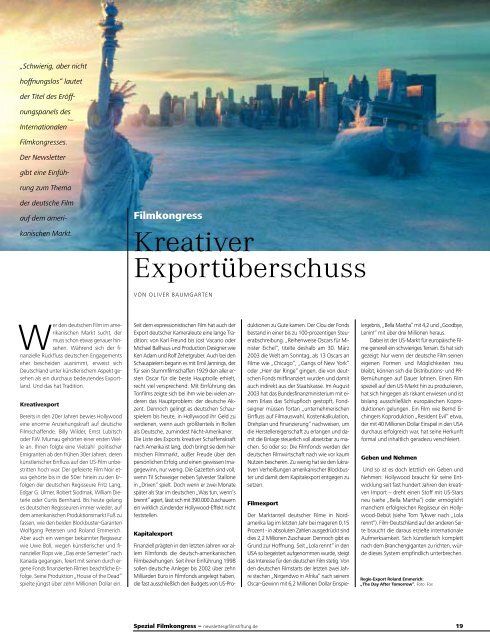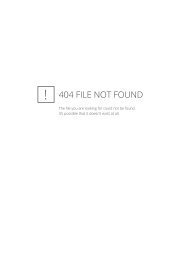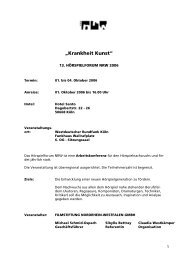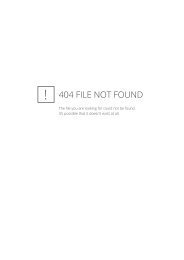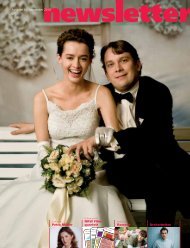als PDF-Dokument herunterladen - Filmstiftung Nordrhein-Westfalen
als PDF-Dokument herunterladen - Filmstiftung Nordrhein-Westfalen
als PDF-Dokument herunterladen - Filmstiftung Nordrhein-Westfalen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
„Schwierig, aber nicht<br />
hoffnungslos“ lautet<br />
der Titel des Eröff-<br />
nungspanels des<br />
Internationalen<br />
Filmkongresses.<br />
Der Newsletter<br />
gibt eine Einfüh-<br />
rung zum Thema<br />
der deutsche Film<br />
auf dem ameri-<br />
kanischen Markt.<br />
Wer den deutschen Film im amerikanischen<br />
Markt sucht, der<br />
muss schon etwas genauer hinsehen.<br />
Während sich der finanzielle<br />
Rückfluss deutschen Engagements<br />
eher bescheiden ausnimmt, erweist sich<br />
Deutschland unter künstlerischem Aspekt gesehen<br />
<strong>als</strong> ein durchaus bedeutendes Exportland.<br />
Und das hat Tradition.<br />
Kreativexport<br />
Bereits in den 20er Jahren bewies Hollywood<br />
eine enorme Anziehungskraft auf deutsche<br />
Filmschaffende. Billy Wilder, Ernst Lubitsch<br />
oder F.W. Murnau gehörten einer ersten Welle<br />
an. Ihnen folgte eine Vielzahl politischer<br />
Emigranten ab den frühen 30er Jahren, deren<br />
künstlerischer Einfluss auf den US-Film unbestritten<br />
hoch war. Der gefeierte Film Noir etwa<br />
gehörte bis in die 50er hinein zu den Erfolgen<br />
der deutschen Regisseure Fritz Lang,<br />
Edgar G. Ulmer, Robert Siodmak, William Dieterle<br />
oder Curtis Bernhard. Bis heute gelang<br />
es deutschen Regisseuren immer wieder, auf<br />
dem amerikanischen Produktionsmarkt Fuß zu<br />
fassen, wie den beiden Blockbuster-Garanten<br />
Wolfgang Petersen und Roland Emmerich.<br />
Aber auch ein weniger bekannter Regisseur<br />
wie Uwe Boll, wegen künstlerischer und finanzieller<br />
Flops wie „Das erste Semester“ nach<br />
Kanada gegangen, feiert mit seinen durch eigene<br />
Fonds finanzierten Filmen beachtliche Erfolge.<br />
Seine Produktion „House of the Dead“<br />
spielte jüngst über zehn Millionen Dollar ein.<br />
Filmkongress<br />
Kreativer<br />
Exportüberschuss<br />
VON OLIVER BAUMGARTEN<br />
Seit dem expressionistischen Film hat auch der<br />
Export deutscher Kameraleute eine lange Tradition:<br />
von Karl Freund bis Jost Vacano oder<br />
Michael Ballhaus und Production Designer wie<br />
Ken Adam und Rolf Zehetgruber. Auch bei den<br />
Schauspielern begann es mit Emil Jannings, der<br />
für sein Stummfilmschaffen 1929 den aller ersten<br />
Oscar für die beste Hauptrolle erhielt,<br />
recht viel versprechend. Mit Einführung des<br />
Tonfilms zeigte sich bei ihm wie bei vielen anderen<br />
das Hauptproblem: der deutsche Akzent.<br />
Dennoch gelingt es deutschen Schauspielern<br />
bis heute, in Hollywood ihr Geld zu<br />
verdienen, wenn auch größtenteils in Rollen<br />
<strong>als</strong> Deutsche, zumindest Nicht-Amerikaner.<br />
Die Liste des Exports kreativer Schaffenskraft<br />
nach Amerika ist lang, doch bringt sie dem heimischen<br />
Filmmarkt, außer Freude über den<br />
persönlichen Erfolg und einen gewissen Imagegewinn,<br />
nur wenig. Die Gazetten sind voll,<br />
wenn Til Schweiger neben Sylvester Stallone<br />
in „Driven“ spielt. Doch wenn er zwei Monate<br />
später <strong>als</strong> Star im deutschen „Was tun, wenn’s<br />
brennt“ agiert, lässt sich mit 390.000 Zuschauern<br />
ein wirklich zündender Hollywood-Effekt nicht<br />
feststellen.<br />
Kapitalexport<br />
Finanziell prägten in den letzten Jahren vor allem<br />
Filmfonds die deutsch-amerikanischen<br />
Filmbeziehungen. Seit ihrer Einführung 1998<br />
sollen deutsche Anleger bis 2002 über zehn<br />
Milliarden Euro in Filmfonds angelegt haben,<br />
die fast ausschließlich den Budgets von US-Pro-<br />
duktionen zu Gute kamen. Der Clou der Fonds<br />
bestand in einer bis zu 100-prozentigen Steuerabschreibung.<br />
„Reihenweise Oscars für Minister<br />
Eichel“, titelte deshalb am 30. März<br />
2003 die Welt am Sonntag, <strong>als</strong> 13 Oscars an<br />
Filme wie „Chicago“, „Gangs of New York“<br />
oder „Herr der Ringe“ gingen, die von deutschen<br />
Fonds mitfinanziert wurden und damit<br />
auch indirekt aus der Staatskasse. Im August<br />
2003 hat das Bundesfinanzministerium mit einem<br />
Erlass das Schlupfloch gestopft, Fondseigner<br />
müssen fortan „unternehmerischen<br />
Einfluss auf Filmauswahl, Kostenkalkulation,<br />
Drehplan und Finanzierung“ nachweisen, um<br />
die Herstellereigenschaft zu erlangen und damit<br />
die Einlage steuerlich voll absetzbar zu machen.<br />
So oder so: Die Filmfonds werden der<br />
deutschen Filmwirtschaft nach wie vor kaum<br />
Nutzen bescheren. Zu wenig hat sie den lukrativen<br />
Verheißungen amerikanischer Blockbuster<br />
und damit dem Kapitalexport entgegen zu<br />
setzen.<br />
Filmexport<br />
Der Marktanteil deutscher Filme in Nordamerika<br />
lag im letzten Jahr bei mageren 0,15<br />
Prozent - in absoluten Zahlen ausgedrückt sind<br />
dies 2,2 Millionen Zuschauer. Dennoch gibt es<br />
Grund zur Hoffnung. Seit „Lola rennt“ in den<br />
USA so begeistert aufgenommen wurde, steigt<br />
das Interesse für den deutschen Film stetig. Von<br />
den deutschen Filmstarts der letzten zwei Jahre<br />
stechen „Nirgendwo in Afrika“ nach seinem<br />
Oscar-Gewinn mit 6,2 Millionen Dollar Einspie-<br />
lergebnis, „Bella Martha“ mit 4,2 und „Goodbye,<br />
Lenin!“ mit über drei Millionen heraus.<br />
Dabei ist der US-Markt für europäische Filme<br />
generell ein schwieriges Terrain. Es hat sich<br />
gezeigt: Nur wenn der deutsche Film seinen<br />
eigenen Formen und Möglichkeiten treu<br />
bleibt, können sich die Distributions- und PR-<br />
Bemühungen auf Dauer lohnen. Einen Film<br />
speziell auf den US-Markt hin zu produzieren,<br />
hat sich hingegen <strong>als</strong> riskant erwiesen und ist<br />
bislang ausschließlich europäischen Koproduktionen<br />
gelungen. Ein Film wie Bernd Eichingers<br />
Koproduktion „Resident Evil“ etwa,<br />
der mit 40 Millionen Dollar Einspiel in den USA<br />
durchaus erfolgreich war, hat seine Herkunft<br />
formal und inhaltlich geradezu verschleiert.<br />
Geben und Nehmen<br />
Und so ist es doch letztlich ein Geben und<br />
Nehmen: Hollywood braucht für seine Entwicklung<br />
seit fast hundert Jahren den kreativen<br />
Import – dreht einen Stoff mit US-Stars<br />
neu (siehe „Bella Martha“) oder ermöglicht<br />
manchem erfolgreichen Regisseur ein Hollywood-Debüt<br />
(siehe Tom Tykwer nach „Lola<br />
rennt“). Film-Deutschland auf der anderen Seite<br />
braucht die daraus erzielte internationale<br />
Aufmerksamkeit. Sich künstlerisch komplett<br />
nach dem Branchengiganten zu richten, würde<br />
dieses System empfindlich unterbrechen.<br />
Regie-Export Roland Emmerich:<br />
„The Day After Tomorrow“, Foto: Fox<br />
Spezial Filmkongress – newsletter@filmstiftung.de 19