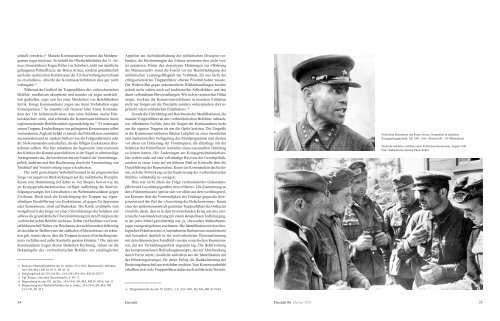Einsicht 06 - Fritz Bauer Institut
Einsicht 06 - Fritz Bauer Institut
Einsicht 06 - Fritz Bauer Institut
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
schnell vorwärts.« 11 Manche Kommandeure weiteten das Mordprogramm<br />
sogar noch aus. So befahl der Oberbefehlshaber der 11. Armee,<br />
Generaloberst Eugen Ritter von Schobert, nicht nur sämtliche<br />
gefangenen Politoffi ziere der Roten Armee, sondern grundsätzlich<br />
auch alle »politischen Kommissare der Zivilverwaltung kurzerhand<br />
zu erschießen«, obwohl die Kommissarrichtlinien dies gar nicht<br />
verlangten. 12<br />
Während der Großteil der Truppenführer die ›verbrecherischen<br />
Befehle‹ rundherum akzeptierte und manche sie sogar ausdrücklich<br />
guthießen, regte sich bei einer Minderheit von Befehlshabern<br />
Kritik. Einige Kommandeure zogen aus ihren Vorbehalten sogar<br />
Konsequenzen. 13 So empörte sich General John Ansat, Kommandeur<br />
der 110. Infanteriedivision, dass seine Soldaten »keine Henkersknechte«<br />
seien, und schränkte die Kommissarrichtlinien durch<br />
reglementierende Befehlszusätze eigenmächtig ein. 14 Er untersagte<br />
seinen Truppen, Erschießungen von gefangenen Kommissaren selbst<br />
vorzunehmen. Zugleich befahl er jedoch, die Politoffi ziere zumindest<br />
auszusondern und an »andere Stellen« wie die Feldgendarmerie oder<br />
die SS-Kommandos auszuliefern, die die fälligen Exekutionen übernehmen<br />
sollten. Wie hier mündeten die begrenzten Interventionen<br />
der Kritiker der Kommissarrichtlinien in der Regel in arbeitsteilige<br />
Arrangements ein, die letztlich nichts am Endziel der Vernichtungspolitik<br />
änderten und ihre Realisierung durch die Atomisierung von<br />
Tatablauf und Verantwortung sogar erleichterten.<br />
Der wohl gewichtigste Vorbehalt bestand in der pragmatischen<br />
Sorge vor negativen Rückwirkungen auf die militärische Disziplin.<br />
Kaum eine Bestimmung rief dabei so viel Skepsis hervor wie die<br />
im Kriegsgerichtsbarkeitserlass verfügte Aufhebung des Strafverfolgungszwanges<br />
bei Gewalttaten von Wehrmachtsoldaten gegen<br />
Zivilisten. Doch auch die Ermächtigung der Truppen zur eigenständigen<br />
Durchführung von Exekutionen, ob gegen Zivilpersonen<br />
oder Kommissare, stieß auf Bedenken. Die Kritik erschöpfte sich<br />
weitgehend in der Sorge vor einer »Verwilderung« der Soldaten und<br />
schloss die grundsätzliche Übereinstimmung mit den Prinzipien der<br />
›verbrecherischen Befehle‹ nicht aus. Selbst ein Hardliner wie Generalfeldmarschall<br />
Walter von Reichenau, der sich besonders frühzeitig<br />
als dezidierter Befürworter der radikalen »Führererlasse« zu erkennen<br />
gab, warnte davor, dass die Truppen in einen »Erschießungstaumel«<br />
verfallen und außer Kontrolle geraten könnten. 15 Die meisten<br />
Kommandeure trugen diesen Bedenken Rechnung, indem sie die<br />
Bekanntgabe der ›verbrecherischen Befehle‹ mit eindringlichen<br />
11 Rede des Oberbefehlshabers der 18. Armee, 25.4.1941, Bundesarchiv-Militärarchiv<br />
(BA-MA), RH 20-18/71, Bl. 20–34.<br />
12 Kriegstagebuch der 239. Inf.Div., 18.6.1941, BA-MA, RH 26-239/17.<br />
13 Vgl. Römer, »›Im alten Deutschland‹«, S. 69–72.<br />
14 Besprechung bei der 102. Inf.Div., 10.6.1941, BA-MA, RH 26-102/6, Anl. 21.<br />
15 Besprechung des Oberbefehlshabers der 6. Armee, 28.4.1941, BA-MA, RH<br />
24-17/41, Bl. 26 f.<br />
Appellen zur Aufrechterhaltung der militärischen Disziplin verbanden,<br />
die Bestimmungen der Erlasse ansonsten aber nicht weiter<br />
antasteten. Hinter den stereotypen Mahnungen zur »Wahrung<br />
der Manneszucht« stand die Furcht vor der Beeinträchtigung der<br />
militärischen Leistungsfähigkeit der Verbände, die aus Sicht der<br />
erfolgsorientierten Truppenführer oberste Priorität haben musste.<br />
Der Widerwillen gegen unkontrollierte Willkürhandlungen beruhte<br />
jedoch nicht zuletzt auch auf traditionellen Selbstbildern und den<br />
damit verbundenen Ehrvorstellungen: Wie sich in vereinzelten Fällen<br />
zeigte, weckten die Kommissarrichtlinien in manchen Einheiten<br />
nicht nur Sorgen um die Disziplin, sondern widersprachen dort regelrecht<br />
»dem soldatischen Empfi nden«. 16<br />
Gerade die Zielrichtung und Reichweite der Modifi kationen, die<br />
manche Truppenführer an den ›verbrecherischen Befehlen‹ anbrachten,<br />
offenbarten freilich, dass die Sorgen der Kommandeure mehr<br />
um die eigenen Truppen als um die Opfer kreisten. Die Eingriffe<br />
in die Kommissarrichtlinien führten lediglich zu einer räumlichen<br />
und institutionellen Verlagerung des Mordprogramms und dienten<br />
vor allem zur Entlastung der Fronttruppen, die allerdings mit der<br />
Selektion der Politoffi ziere weiterhin einen essenziellen Tatbeitrag<br />
zu leisten hatten. Die Änderungen am Kriegsgerichtsbarkeitserlass<br />
zielten nicht auf eine vollständige Revision der Gewaltpolitik,<br />
sondern in erster Linie auf ein höheres Maß an Kontrolle über die<br />
Durchführung der Repressalien. Kaum ein Kommandeur dachte daran,<br />
sich der Mitwirkung an der Realisierung der ›verbrecherischen<br />
Befehle‹ vollständig zu versagen.<br />
Dies war nicht allein die Folge verabsolutierter Gehorsamspfl<br />
icht und Loyalität gegenüber dem »Führer«. Die Zustimmung zu<br />
den »Führererlassen« speiste sich vor allem aus dem weithin geteilten<br />
Konsens über die Notwendigkeit des Feldzugs gegen die Sowjetunion<br />
und das Ziel der »Ausrottung des Bolschewismus«. Kaum<br />
einer der antikommunistisch gesinnten Truppenführer des Ostheeres<br />
zweifelte daran, dass es in dem bevorstehenden Krieg um eine existenzielle<br />
Auseinandersetzung mit einem skrupellosen Todfeind ging,<br />
in der jedes Mittel gerechtfertigt war, ja, »besondere Maßnahmen«<br />
sogar zwingend geboten erschienen. Die Identifi kation mit den ideologischen<br />
Prämissen des »Unternehmens Barbarossa« manifestierte<br />
sich besonders deutlich in der weitverbreiteten Übereinstimmung<br />
mit dem dämonischen Feindbild von den sowjetischen Kommissaren,<br />
das der Vernichtungspolitik zugrunde lag. Die Befürwortung<br />
des kompromisslosen Befriedungskonzepts, das auf Abschreckung<br />
durch Terror setzte, resultierte außerdem aus der Identifi kation mit<br />
der Blitzkriegsstrategie, für deren Erfolg die Radikalisierung der<br />
Besatzungsherrschaft unverzichtbar erschien. Vom Kommissarbefehl<br />
erhofften sich viele Truppenführer daher auch militärische Vorteile,<br />
16 Tätigkeitsbericht (Ic) der 78. Inf.Div., 1.6.–22.6.1941, BA-MA, RH 26-78/64.<br />
34 <strong>Einsicht</strong><br />
<strong>Einsicht</strong> <strong>06</strong> Herbst 2011<br />
Politischer Kommissar der Roten Armee, fotografi ert in deutscher<br />
Kriegsgefangenschaft, Juli 1941. Foto: ullstein bild – SV-Bilderdienst<br />
Deutsche Soldaten verhören einen Politischen Kommissar, August 1941.<br />
Foto: Süddeutsche Zeitung Photo/Scherl<br />
35