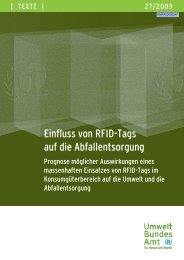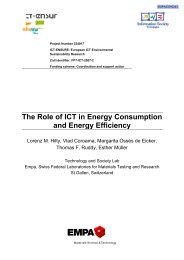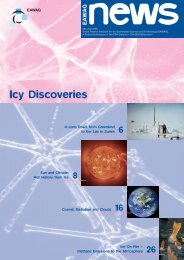Jahresbericht 1986 - Eawag-Empa Library
Jahresbericht 1986 - Eawag-Empa Library
Jahresbericht 1986 - Eawag-Empa Library
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
im Zeitalter der strengen Abgas-Gesetzgebung ausgespielt,<br />
wird dann vielleicht eine Korrektur erhalten.<br />
Abteilung 135, Bau-, Wasserchemie/Petrographie:<br />
Zwei Schwerpunktbereiche führten in den beiden letzten<br />
Jahren zu einer ungewöhnlichen Steigerung des<br />
Auftragsvolumens:<br />
Nach der Veröffentlichung des Schlussberichtes<br />
des Bundesamtes für Umweltschutz über «Asbest in<br />
schweizerischen Sportstätten/Gesundheitsrisiken<br />
und Sanierungsmöglichkeiten» im Februar 1985,<br />
mussten zahlreiche Bauisolationsmaterialien auf deren<br />
allfälligen Asbestgehalt geprüft werden. Die Abteilung<br />
untersuchte bis Ende <strong>1986</strong> etwa 650 eingesandte Proben<br />
auf Asbestart und -gehalt. Rund 33% dieser Proben<br />
enthielten Chrysotil in Mengen von ca. 14 bis 23<br />
Masse-%. Asbestreiche Spritzmassen von Amosit<br />
bzw. Krokydolith waren mit ca. 15.5 bzw. 14% aller<br />
Proben vertreten (Asbestgehalte von ca. 75 bis 85<br />
Masse-0/o). Bemerkenswert ist es jedoch, dass 37.5%<br />
der Proben asbestfrei waren und grösstenteils lediglich<br />
aus Mineralwollfasern oder aus organischen Fasern<br />
bestanden; ein kleiner Teil davon enthielt überhaupt<br />
keine Fasern, sondern wurde als zu den Leichtmörtelbeschichtungen<br />
gehörig identifiziert (etwa 10 0/0<br />
aller Proben). Dies zeigt, dass eine genaue Überprüfung<br />
zweifelhafter Isolationsmaterialien zur Beurteilung<br />
von asbestbedingten gesundheitlichen Risiken<br />
nach wie vor ausschlaggebend ist, und dass in etwas<br />
* *<br />
* * *<br />
* *<br />
*<br />
* * *<br />
• ungestrichene Betonoberfläche<br />
* gestrichene Betonoberfläche<br />
e o'bô0?'<br />
• a°<br />
**<br />
..<br />
8<br />
*<br />
260<br />
130<br />
I I o<br />
0,4 0,8 1,6 3,2 6,4<br />
*<br />
*<br />
Chloridgehalte in 0+10mm Tiefe<br />
Abb.4.4-1 Chloridgehalte über 0.4 Masse-Wo (bezogen auf den Zementanteil)<br />
in der äussersten Betonschicht im Vergleich mit den<br />
Chloridgehalten in der Tiefe der normalen Armierungsüberdeckung<br />
bei ungestrichenen und bei gestrichenen Oberflächen von untersuchten<br />
Betonbohrkernen. Werte unter 1 bedeuten, dass in 20 bis<br />
30 mm Tiefe grössere Chloridgehalte als in der äussersten Betonschicht<br />
vorliegen (4-50789)<br />
65<br />
32<br />
16<br />
8<br />
4<br />
2<br />
m<br />
IL-<br />
0<br />
N<br />
0<br />
c<br />
.<br />
-C<br />
N<br />
d<br />
H20 + CO2<br />
H 2 0 + Cl-<br />
H20 + CO2<br />
H 2 0 + Cl-<br />
karbonatisierter Beton<br />
Abb.4.4-2 Schematische Darstellung der Feuchtigkeitszirkulation<br />
in ungestrichenem/ rechts in gestrichenem Beton. Im gestrichenen<br />
Beton werden die in der äussersten Betonschicht angelagerten<br />
Chlor-Ionen durch die Feuchtigkeit in die Tiefe befördert. Die Kohlensäure<br />
kann mit der Feuchtigkeit, die bei Fehlstellen in der Beschichtung<br />
eindringt, ebenfalls tiefer wirken (4-50790)<br />
mehr als einem Drittel aller Fälle unnötige Sanierungskosten<br />
erspart werden können.<br />
Im Bereich der Überwachung und Sanierung von<br />
Betonbauwerken mussten sehr viele Bohrkerne auf<br />
Chloridgehalt und Chlorideindringtiefe sowie auf Karbonatisierungszustand<br />
geprüft werden. Insgesamt<br />
wurden über 1000 Proben untersucht, wobei die meisten<br />
aus dem Tiefbau stammten (Brücken, Tunnels,<br />
Stützwerke usw.), die wegen der Anwendung von Tausalz<br />
teilweise stark mit Chlorid durchsetzt waren.<br />
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigten<br />
überraschenderweise, dass Betonproben, deren<br />
Oberfläche mit einem wasserdichten Anstrich versehen<br />
waren, meistens wesentlich tiefer karbonatisiert<br />
waren und fast durchwegs eine viel tiefere Chloridinfiltration<br />
aufwiesen als Betonproben mit roher, ungestrichener<br />
Oberfläche (Abb. 4.4-1). Diese Erscheinung<br />
wurde in den beiden letzten Jahren wiederholt nachgeprüft<br />
und bestätigt. Sie ist dadurch zu erklären, dass<br />
die wasserdichte Beschichtung der Betonoberfläche<br />
die rasche Verdunstung der an undichten Stellen eindringenden<br />
Feuchtigkeit behindert, so dass diese in<br />
tiefere Betonpartien zurückgedrängt wird und dabei<br />
gelöste Salze aus der äussersten Schicht in die Tiefe<br />
des Betongefüges befördert (Abb. 4.4-2). Bei roher,<br />
ungestrichener Betonoberfläche kann die Feuchtigkeit<br />
hingegen rasch verdunsten, so dass sie nicht in Richtung<br />
Betonkern ausweichen muss. Dadurch bleiben<br />
die Chloride in der äussersten Betonschicht. Auch das<br />
tiefere Eindringen der Karbonatisierungsfront beim<br />
überstrichenen Beton kann durch die tiefere Wirkung<br />
der Wechselzyklen feucht/trocken in den Poren (welche<br />
die Kohlendioxid-Zufuhr begünstigen) erklärt werden.<br />
Diese Erkenntnisse haben Konsequenzen für die<br />
Praxis der Betonschutztechnik und der Betonsanierung.<br />
Wasserdichte Anstriche und Beschichtungen<br />
dürfen jedoch nicht unbedacht angeordnet und ausgeführt<br />
werden. Ein Beton, der bereits in Oberflächennähe<br />
unzulässige Mengen von Chlorid enthält, darf nie-<br />
31