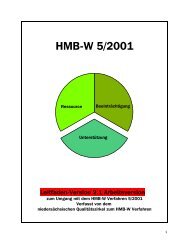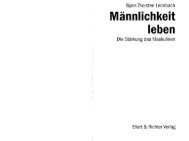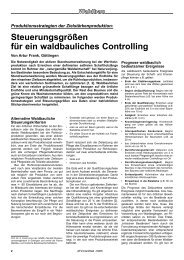Geschlecht und esellschaf eraus e geben v® Ilse Lenz ichik® Sigrid ...
Geschlecht und esellschaf eraus e geben v® Ilse Lenz ichik® Sigrid ...
Geschlecht und esellschaf eraus e geben v® Ilse Lenz ichik® Sigrid ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
universitäre Forschung einzudringen, haben dieser Doktrin nicht nur zuwidergehandelt,<br />
sie haben auch deren Gr<strong>und</strong>annahmen in Frage gestellt, indem<br />
sie Unterschiede bei den geistigen Fähigkeiten von Männern <strong>und</strong> Frauen untersuchten.<br />
Gef<strong>und</strong>en haben sie sehr wenig."<br />
Dieses skandalöse Ergebnis hat eine große Menge an Nachfolgeuntersuchungen<br />
nach sich gezogen, die sich vom Ende des vergangenen Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
bis in unsere Zeit erstreckten. Dabei ging es nicht nur um die mentalen<br />
Fähigkeiten, sondern auch um Gefühle, Einstellungen, Persönlichkeitseigenschaften,<br />
Interessen, eigentlich um alles, was Psychologen glaubten messen<br />
zu können. Es gibt eine ungeheure Menge an Untersuchungen zu <strong>Geschlecht</strong>sunterschieden.<br />
Methodisch gibt es dabei keine großen Schwierigkeiten,<br />
<strong>und</strong> das Interesse an den Ergebnissen scheint nicht zu versiegen.<br />
Dieses Interesse an sich ist schon kurios, da die Ergebnisse sich nicht ändern.<br />
<strong>Geschlecht</strong>sunterschiede sind - bei fast allen untersuchten psychologischen<br />
Merkmalen - entweder nicht vorhanden oder sehr gering. Jedenfalls<br />
sind sie viel geringer als die Unterschiede zwischen sozialen Positionen, die<br />
man in der Regel aber mit den angeblichen psychischen Unterschieden rechtfertigt<br />
- zum Beispiel unterschiedliche Löhne, unterschiedliche Fähigkeiten<br />
bei der Kinderversorgung <strong>und</strong> sehr ungleicher Zugang zur g<strong>esellschaf</strong>tlicher<br />
Macht. Wenn Untersuchungen einer statistischen Meta-Analyse unterzogen<br />
werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, daß einige <strong>Geschlecht</strong>sunterschiede<br />
bei psychischen Charakteristika sichtbar werden. Aber ihr geringes Ausmaß<br />
würde sie kaum als bemerkenswertes Phänomen erscheinen lassen, wären wir<br />
kulturell nicht bereits darauf getrimmt, sie überzubewerten - wie in dem<br />
Zeitungsartikel über das unterschiedliche Kommunikationsverhalten von<br />
Frauen <strong>und</strong> Männern, den ich zu Beginn zitiert habe. Cynthia Epstein hat ihrem<br />
Buch über diese Thematik den treffenden Titel „Deceptive Distinctions"<br />
(Trügerische Unterschiede) ge<strong>geben</strong>."<br />
Mitte des Jahrh<strong>und</strong>ert wurde die Erforschung der <strong>Geschlecht</strong>sunterschiede<br />
mit einem Konzept konfrontiert, das ihren Forschungsgegenstand auf<br />
zeitgemäße Weise zu erklären schien: das Konzept der sozialen Rolle. Daraus<br />
entstand der Begriff „<strong>Geschlecht</strong>srolle ° , der mittlerweile auch bis in die Alltagssprache<br />
vorgedrungen ist.<br />
Die Vorstellung einer <strong>Geschlecht</strong>srolle ist uns mittlerweile so vertraut,<br />
daß es sich lohnt, die Ursprünge genauer zu betrachten. Die Metapher vom<br />
menschlichen Leben als einem Theaterstück ist natürlich alt - schon Shake<br />
speare hat sie benutzt. Aber der Begriff „Rolle" als methodisches Konzept<br />
34<br />
35<br />
40<br />
Rosenberg 1982.<br />
Epstein 1988. Die sehr umfangreiche Zusammenstellung von Maccoby <strong>und</strong> Jacklin<br />
1975 hat ein allgemeines Muster von Bef<strong>und</strong>en zu <strong>Geschlecht</strong>sunterschieden etabliert.<br />
Die meta-analytische Literatur (z.B. Eagly 1987) hat bewußt versucht, diese<br />
Position einzunehmen. Obwohl er viele Argumente überdehnt, gelingt es Eagly dennoch<br />
nicht, nachzuweisen, daß <strong>Geschlecht</strong>sunterschiede Persönlichkeitszüge determinieren<br />
können.<br />
der Sozialwissenschaft, das soziales Verhalten ganz allgemein erklären soll,<br />
entstand erst in den 30er Jahren. Damit ließ sich die Vorstellung von einer<br />
Stellung in der sozialen Struktur mit der Idee kultureller Normen verbinden.<br />
Und aufgr<strong>und</strong> der Bemühungen unzähliger Anthropologen, Soziologen <strong>und</strong><br />
Psychologen wurde der Begriff gegen Ende der 50er Jahre in das herkömmliche<br />
Vokabular der Sozialwissenschaften aufgenommen."<br />
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Rollenkonzept mit dem sozialen <strong>Geschlecht</strong><br />
zu verbinden. Einerseits kann man Rollen als abhängig von bestimmten<br />
Situationen betrachten. Zum Beispiel hat Mirra Komarovsky in ih<br />
rer klassischen Untersuchung von Arbeiterfamilien („Blue Collar Marrlage",<br />
1964) detailliert dieses rollengeb<strong>und</strong>ene Verhalten während der Werbephase<br />
<strong>und</strong> in der Ehe beschrieben.<br />
Sehr viel gebräuchlicher ist die zweite Möglichkeit, wo man Mannsein<br />
oder Frausein als ein Bündel allgemeiner Erwartungen versteht, das dem biologischen<br />
<strong>Geschlecht</strong> anhaftet - die <strong>Geschlecht</strong>srolle. Bei diesem Ansatz gibt<br />
es in jedem kulturellen Kontext immer zwei <strong>Geschlecht</strong>srollen, eine männliche<br />
<strong>und</strong> eine weibliche. Männlichkeit <strong>und</strong> Weiblichkeit werden dabei als die<br />
verinnerlichten <strong>Geschlecht</strong>srollen betrachtet, als Folge sozialen Lernens bzw.<br />
der „Sozialisation".<br />
Dieses Konzept paßt so gut zur Vorstellung angeborener <strong>Geschlecht</strong>sunterschiede,<br />
die sich leicht durch <strong>Geschlecht</strong>srollen erklären lassen, daß<br />
beide Ideen seit den 40er Jahren dauerhaft miteinander verwachsen sind. Es<br />
gibt immer noch Fachzeitschriften, die Artikel veröffentlichen, in denen die<br />
(gewöhnlich geringfügigen) <strong>Geschlecht</strong>sunterschiede schlicht als <strong>Geschlecht</strong>srollen<br />
bezeichnet werden.<br />
In der Regel betrachtet man <strong>Geschlecht</strong>srollen aber als die kulturelle<br />
Ausformung der biologischen <strong>Geschlecht</strong>sunterschiede. Mitte der 50er Jahre<br />
entwickelte Talcott Parsons in „Family, Sozialisation and Interaction Pro<br />
cess" einen anspruchsvolleren Ansatz. Er setzte den Unterschied zwischen<br />
männlicher <strong>und</strong> weiblicher <strong>Geschlecht</strong>srolle mit der Unterscheidung von „instrumenteller"<br />
<strong>und</strong> „expressiver" Rolle in der Familie, als einer kleinen<br />
Gruppe, gleich. Das soziale <strong>Geschlecht</strong> wird hier von einem allgemeinen soziologischen<br />
Gesetz abgeleitet, nämlich von den unterschiedlichen Funktionen<br />
in sozialen Gruppen. 37<br />
Die Vorstellung, daß Männlichkeit durch die Verinnerlichung einer<br />
männlichen <strong>Geschlecht</strong>srolle entsteht, war offen für soziale Veränderungen,<br />
was manchmal als Vorteil der Rollentheorie gegenüber der Psychoanalyse<br />
gesehen wurde. Da die Rollennormen soziale Fakten darstellen, können sie<br />
auch durch soziale Prozesse verändert werden. Das wird immer dann gesche-<br />
36 Unter anderem durch Florian Znaniecki, Talcott Parsons, Ralph Linton, Siegfried<br />
Nadel, Bruce Biddle. Ich habe diese Entwicklung in Connell 1979 beschrieben.<br />
37 Komarowsky 1964, Parsons <strong>und</strong> Bales 1956. Eine ausführlichere Beschreibung bietet<br />
Carrigan et al. 1985.<br />
41