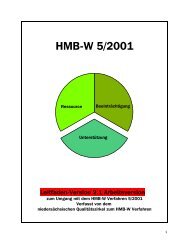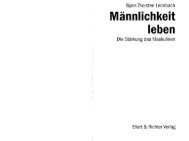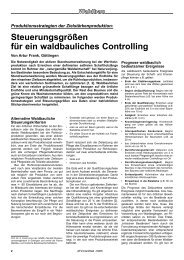Geschlecht und esellschaf eraus e geben v® Ilse Lenz ichik® Sigrid ...
Geschlecht und esellschaf eraus e geben v® Ilse Lenz ichik® Sigrid ...
Geschlecht und esellschaf eraus e geben v® Ilse Lenz ichik® Sigrid ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
hat, im Zuge der zunehmenden Kolonialisierung <strong>und</strong> kapitalistischer Wirtschaftsbeziehungen<br />
(siehe auch das achte Kapitel).<br />
Aber das Konzept weist auch eine innere Relationalität auf. Ohne den<br />
Kontrastbegriff „Weiblichkeit" existiert „Männlichkeit" nicht. Eine Kultur,<br />
die Frauen <strong>und</strong> Männer nicht als Träger <strong>und</strong> Trägerinnen polarisierter Cha<br />
raktereigenschaften betrachtet, zumindest prinzipiell, hat kein Konzept von<br />
Männlichkeit im Sinne der modernen westlichen Kultur.<br />
Die Geschichtsforschung nimmt an, daß dies in der europäischen Kultur<br />
bis zum 18. Jahrh<strong>und</strong>ert der Fall war. Frauen wurden zwar als unterschieden<br />
von Männern wahrgenommen, aber im Sinne unvollkommener oder mangelhafterer<br />
Exemplare des gleichen Charakters (zum Beispiel mit weniger Vernunft<br />
begabt). Männer <strong>und</strong> Frauen wurden nicht als Träger <strong>und</strong> Trägerinnen<br />
qualitativ anderer Charaktere betrachtet; dieser Gedanke entstand erst mit der<br />
bourgeoisen Ideologie der „getrennten Sphären" im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert.'<br />
Unser Konzept von Männlichkeit scheint historisch also ziemlich neuen<br />
Datums zu sein, höchsten ein paar Jahrh<strong>und</strong>erte alt. Um überhaupt von<br />
„Männlichkeit" sprechen zu können, stellen wir auf kulturell spezifische<br />
Weise „<strong>Geschlecht</strong>" her. Das sollte man im Kopf behalten, wenn man beansprucht,<br />
universelle Wahrheiten über Männlichkeit <strong>und</strong> über das Mannsein<br />
entdeckt zu haben.<br />
Die meisten Definitionen von Männlichkeit setzten unseren kulturellen<br />
Standpunkt unhinterfragt voraus, verfolgen aber unterschiedliche Strategien,<br />
wenn es darum geht, eine männliche Person zu charakterisieren. Vier hauptsächliche<br />
Strategien lassen sich hinsichtlich ihrer Logik unterscheiden, obwohl<br />
sie in der Praxis oft miteinander kombiniert werden.<br />
Essentialistische Definitionen greifen für gewöhnlich einen Aspekt h<strong>eraus</strong>,<br />
der das Gr<strong>und</strong>prinzip von Männlichkeit ausmachen soll, <strong>und</strong> erklären<br />
daraus das Leben von Männern. Freud liebäugelte mit einer essentialistischen<br />
Definition, als er Männlichkeit mit Aktivität gleichsetzte <strong>und</strong> der weiblichen<br />
Passivität gegenüberstellte - aber er kam dann zu dem Schluß, daß diese<br />
Gleichsetzung zu sehr vereinfache. Spätere Versuche, eine Essenz von<br />
Männlichkeit zu erfassen, sind sehr unterschiedlich: Risikofreudigkeit, Verantwortlichkeit,<br />
Unverantwortlichkeit, Aggression, die Energie des Zeus...<br />
Am schönsten ist vielleicht die Idee des Soziobiologen Lionel Tiger, daß<br />
wahre Männlichkeit, die Männerbünden <strong>und</strong> Krieg zugr<strong>und</strong>eliegt, durch<br />
„hard and heavy" -Phänomene hervorgerufen wird. Viele Heavy-Metal-Fans<br />
würden dem wohl zustimmen.<br />
2<br />
88<br />
Bloch 1978 beschäftigt sich mit der protestantischen Mittelschicht in England <strong>und</strong><br />
Nordamerika. Laqueur 1990 argumentiert ähnlich, aber etwas allgemeiner in Bezug<br />
auf den Körper.<br />
Tiger 1969 (S. 211). Tiger gibt sich Vermutungen hin, daß der Krieg Teil einer<br />
„männlichen Ästhetik" sein könnte, wie das Dahinrasen mit einem Rennwagen. Die<br />
Lektüre dieser Passage lohnt sich immer noch, genauso wie der „Eisenhans" von<br />
Robert Bly, ein schlagendes Beispiel dafür, was für verwirrte Gedanken Männerthe-<br />
Der Schwachpunkt dieses Ansatzes ist offensichtlich: die Wahl des jeweiligen<br />
essentiellen Kriteriums ist recht willkürlich. Nichts zwingt unterschiedliche<br />
Essentialisten dazu, sich zu einigen, <strong>und</strong> in der Tat ist ihnen dies<br />
auch oft nicht möglich. Behauptungen einer universalen Basis von Männlichkeit<br />
sagen mehr über das Ethos derjenigen aus, die sie aussprechen, als<br />
über sonst irgendetwas.<br />
Die positivistische Sozialwissenschaft hat den Anspruch, Fakten zu produzieren<br />
<strong>und</strong> strebt deshalb nach einer einfachen Definition von Männlichkeit:<br />
männlich ist, wie Männer wirklich sind. Diese Definition liegt auch den<br />
männlich/weiblich (M/F) Skalen der Psychologie zugr<strong>und</strong>e, deren Items<br />
durch den Nachweis validiert werden, daß sie tatsächlich statistisch zwischen<br />
Gruppen von Männern <strong>und</strong> Frauen zu trennen vermögen. Darauf basieren<br />
auch diejenigen ethnographischen Männlichkeitsdiskussionen, die das Muster<br />
männlichen Lebens in einer bestimmten Kultur beschreiben <strong>und</strong> - wie<br />
immer es auch beschaffen sein mag - dieses Muster als „Männlichkeit" bezeichnen.'<br />
Es gibt hier drei Schwierigkeiten. Zunächst gibt es keine Beschreibung<br />
ohne einen Standpunkt, wie uns die moderne Erkenntnistheorie gezeigt hat.<br />
Die angeblich neutralen Beschreibungen, auf denen diese Definitionen beru<br />
hen, basieren selbst auf Annahmen über das soziale <strong>Geschlecht</strong>. Eigentlich ist<br />
es völlig einleuchtend, daß man, um eine M/F-Skala zu erstellen, eine Vorstellung<br />
davon haben muß, was man bei der Erstellung der Items auflistet<br />
bzw. berücksichtigt.<br />
Zweitens: Um aufzulisten, was Männer <strong>und</strong> Frauen machen, bedarf es<br />
bereits einer Aufteilung in die Kategorien „Männer" <strong>und</strong> „Frauen". Suzanne<br />
Kessler <strong>und</strong> Wendy McKenna zeigen in ihrer klassischen ethnomethodologi<br />
scheu Untersuchung der <strong>Geschlecht</strong>erforschung, daß dabei zwangsläufig eine<br />
soziale Attribution mit eher klischeehafter <strong>Geschlecht</strong>stypologie stattfindet.<br />
Das positivistische Vorgehen basiert demnach genau auf jenen Typisierungen,<br />
die eigentlich erforscht werden sollen.<br />
Und drittens verhindert eine solche Männlichkeitsdefinition, daß man<br />
auch eine Frau als „männlich" oder einen Mann als „weiblich" oder bestimmte<br />
Verhaltensweisen oder Einstellungen als „männlich" oder „weib<br />
lich" beschreiben könnte, unabhängig davon, bei wem man sie feststellt. Das<br />
ist kein trivialer Gebrauch der Begriffe, sondern beispielsweise entscheidend<br />
für die psychoanalytische Vorstellung von den Widersprüchen in einer Persönlichkeit.<br />
men hervorrufen können, in diesem Fall mit dem Beigeschmack dessen, was G.<br />
Wright Mills „verrückte Realität" genannt hat.<br />
3 Die zutiefst verwirrte Logik der M/F-Skalen offenbart sich in einem klassischen Aufsatz<br />
von Constantinople 1973. Der ethnographische Positivismus erreicht mit Gilmore<br />
1991 einen Tiefpunkt, hin- <strong>und</strong> herschwankend zwischen normativer Theorie <strong>und</strong><br />
positivistischer Praxis.<br />
89