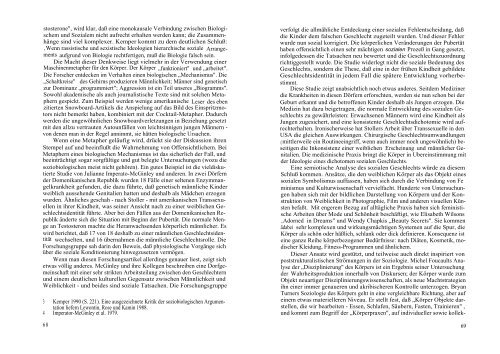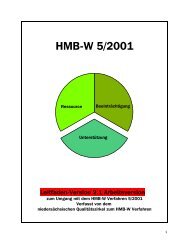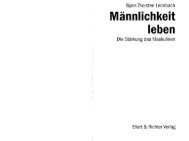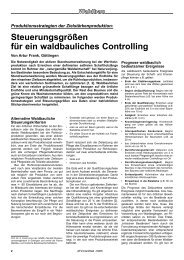Geschlecht und esellschaf eraus e geben v® Ilse Lenz ichik® Sigrid ...
Geschlecht und esellschaf eraus e geben v® Ilse Lenz ichik® Sigrid ...
Geschlecht und esellschaf eraus e geben v® Ilse Lenz ichik® Sigrid ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
stosterone", wird klar, daß eine monokausale Verbindung zwischen Biologischem<br />
<strong>und</strong> Sozialem nicht aufrecht erhalten werden kann; die Zusammenhänge<br />
sind viel komplexer. Kemper kommt zu dem deutlichen Schluß:<br />
„Wenn rassistische <strong>und</strong> sexistische Ideologien hierarchische soziale Arrangements<br />
aufgr<strong>und</strong> von Biologie rechtfertigen, muß die Biologie falsch sein.<br />
Die Macht dieser Denkweise liegt vielmehr in der Verwendung einer<br />
Maschinenmetapher für den Körper. Der Körper „funktioniert" <strong>und</strong> „arbeitet".<br />
Die Forscher entdecken im Verhalten einen biologischen „Mechanismus". Die<br />
„Schaltkreise" des Gehirns produzieren Männlichkeit; Männer sind genetisch<br />
zur Dominanz „programmiert"; Aggression ist ein Teil unseres „Biogramms".<br />
Sowohl akademische als auch journalistische Texte sind mit solchen Metaphern<br />
gespickt. Zum Beispiel werden wenige amerikanische Leser des eben<br />
zitierten Snowboard-Artikels die Anspielung auf das Bild des Einspritzmotors<br />
nicht bemerkt haben, kombiniert mit der Cocktail-Metapher. Dadurch<br />
werden die ungewöhnlichen Snowboardverletzungen in Beziehung gesetzt<br />
mit den allzu vertrauten Autounfällen von leichtsinnigen jungen Männern -<br />
von denen man in der Regel annimmt, sie hätten biologische Ursachen.<br />
Wenn eine Metapher geläufig wird, drückt sie der Diskussion ihren<br />
Stempel auf <strong>und</strong> beeinflußt die Wahrnehmung von Offensichtlichem. Bei<br />
Metaphern eines biologischen Mechanismus ist das sicherlich der Fall, <strong>und</strong><br />
beeinträchtigt sogar sorgfältige <strong>und</strong> gut belegte Untersuchungen (wozu die<br />
soziobiologischen meist nicht gehören). Ein gutes Beispiel ist die vieldiskutierte<br />
Studie von Julianne Imperato-McGinley <strong>und</strong> anderen. In zwei Dörfern<br />
der Domenikanischen Republik wurden 18 Fälle einer seltenen Enzymmangelkrankheit<br />
gef<strong>und</strong>en, die dazu führte, daß genetisch männliche Kinder<br />
weiblich aussehende Genitalien hatten <strong>und</strong> deshalb als Mädchen erzogen<br />
wurden. Ähnliches geschah - nach Stoller - mit amerikanischen Transsexuellen<br />
in ihrer Kindheit, was seiner Ansicht nach zu einer weiblichen <strong>Geschlecht</strong>sidentität<br />
führte. Aber bei den Fällen aus der Domenikanischen Republik<br />
änderte sich die Situation mit Beginn der Pubertät. Die normale Menge<br />
an Testosteron machte die Heranwachsenden körperlich männlicher. Es<br />
wird berichtet, daß 17 von 18 deshalb zu einer männlichen <strong>Geschlecht</strong>sidentität<br />
wechselten, <strong>und</strong> 16 übernahmen die männliche <strong>Geschlecht</strong>srolle. Die<br />
Forschungsgruppe sah darin den Beweis, daß physiologische Vorgänge sich<br />
über die soziale Konditionierung hinwegzusetzen vermögen.<br />
Wenn man diesen Forschungsartikel allerdings genauer liest, zeigt sich<br />
etwas völlig anderes. McGinley <strong>und</strong> ihre Kollegen beschreiben eine Dorfgemeinschaft<br />
mit einer sehr strikten Arbeitsteilung zwischen den <strong>Geschlecht</strong>ern<br />
<strong>und</strong> einem deutlichen kulturellen Gegensatz zwischen Männlichkeit <strong>und</strong><br />
Weiblichkeit - <strong>und</strong> beides sind soziale Tatsachen. Die Forschungsgruppe<br />
3 Kemper 1990 (S. 221). Eine ausgezeichnete Kritik der soziobiologischen Argumentation<br />
liefern Lewontin, Rose <strong>und</strong> Kamin 1988.<br />
4 Imperator-McGinley et al. 1979.<br />
68<br />
verfolgt die allmähliche Entdeckung einer sozialen Fehlentscheidung, daß<br />
die Kinder dem falschen <strong>Geschlecht</strong> zugeteilt wurden. Und dieser Fehler<br />
wurde nun sozial korrigiert. Die körperlichen Veränderungen der Pubertät<br />
haben offensichtlich einen sehr mächtigen sozialen Prozeß in Gang gesetzt,<br />
infolgedessen die Tatsachen neu bewertet <strong>und</strong> die <strong>Geschlecht</strong>szuordnung<br />
richtiggestellt wurde. Die Studie widerlegt nicht die soziale Bedeutung des<br />
<strong>Geschlecht</strong>s, sondern die These, daß eine in der frühen Kindheit gebildete<br />
<strong>Geschlecht</strong>sidentität in jedem Fall die spätere Entwicklung vorherbestimmt.<br />
Diese Studie zeigt unabsichtlich noch etwas anderes. Seitdem Mediziner<br />
die Krankheiten in diesen Dörfern erforschten, werden sie nun schon bei der<br />
Geburt erkannt <strong>und</strong> die betroffenen Kinder deshalb als Jungen erzogen. Die<br />
Medizin hat dazu beigetragen, die normale Entwicklung des sozialen <strong>Geschlecht</strong>s<br />
zu gewährleisten: Erwachsenen Männern wird eine Kindheit als<br />
Jungen zugesichert, <strong>und</strong> eine konsistente <strong>Geschlecht</strong>sdichotomie wird aufrechterhalten.<br />
Ironischerweise hat Stollers Arbeit über Transsexuelle in den<br />
USA die gleichen Auswirkungen. Chirurgische <strong>Geschlecht</strong>sumwandlungen<br />
(mittlerweile ein Routineeingriff, wenn auch immer noch ungewöhnlich) beseitigen<br />
die Inkonsistenz einer weiblichen Erscheinung .<strong>und</strong> männlicher Genitalien.<br />
Die medizinische Praxis bringt die Körper in Ubereinstimmung mit<br />
der Ideologie eines dichotomen sozialen <strong>Geschlecht</strong>s.<br />
Eine semiotische Analyse des sozialen <strong>Geschlecht</strong>s würde zu diesem<br />
Schluß kommen. Ansätze, die den weiblichen Körper als das Objekt eines<br />
sozialen Symbolismus auffassen, haben sich durch die Verbindung von Fe<br />
minismus <strong>und</strong> Kulturwissenschaft vervielfacht. H<strong>und</strong>erte von Untersuchungen<br />
haben sich mit der bildlichen Darstellung von Körpern <strong>und</strong> der Konstruktion<br />
von Weiblichkeit in Photographie, Film <strong>und</strong> anderen visuellen Künsten<br />
befaßt. Mit engerem Bezug auf alltägliche Praxis haben sich feministische<br />
Arbeiten über Mode <strong>und</strong> Schönheit beschäftigt, wie Elisabeth Wilsons<br />
„Adorned in Dreams" <strong>und</strong> Wendy Chapkis „Beauty Secrets". Sie kommen<br />
ädabei sehr komplexen <strong>und</strong> wirkungsmächtigen Systemen auf die Spur, die<br />
Körper als schön oder häßlich, schlank oder dick definieren. Konsequenz ist<br />
eine ganze Reihe körperbezogener Bedürfnisse: nach Diäten, Kosmetik, modischer<br />
Kleidung, Fitness-Programmen <strong>und</strong> ähnlichem.<br />
Dieser Ansatz wird gestützt, <strong>und</strong> teilweise auch direkt inspiriert von<br />
poststrukturalistischen Strömungen in der Soziologie. Michel Foucaults Analyse<br />
der „Disziplinierung" des Körpers ist ein Ergebnis seiner Untersuchung<br />
der Wahrheitsproduktion innerhalb von Diskursen; der Körper wurde zum<br />
Objekt neuartiger Disziplinierungswissenschaften, als neue Machtstrategien<br />
ihn einer immer genaueren <strong>und</strong> akribischeren Kontrolle unterzogen. Bryan<br />
Turners Soziologie des Körpers geht in eine vergleichbare Richtung, aber auf<br />
einem etwas materielleren Niveau. Er stellt fest, daß „Körper Objekte darstellen,<br />
die wir bearbeiten - Essen, Schlafen, Säubern, Fasten, Trainieren" ,<br />
<strong>und</strong> kommt zum Begriff der „Körperpraxen", auf individueller sowie kollek-<br />
69