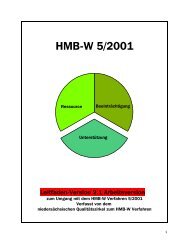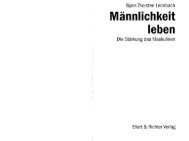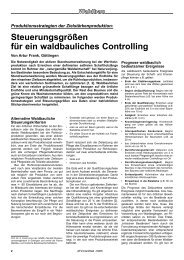Geschlecht und esellschaf eraus e geben v® Ilse Lenz ichik® Sigrid ...
Geschlecht und esellschaf eraus e geben v® Ilse Lenz ichik® Sigrid ...
Geschlecht und esellschaf eraus e geben v® Ilse Lenz ichik® Sigrid ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diese Ambivalenz wird bedingt durch das Konzept der „<strong>Geschlecht</strong>srolle".<br />
Die Analyse von <strong>Geschlecht</strong>srollen geht in ihren logischen Prämissen<br />
davon aus, daß die beiden Rollen sich wechselseitig bedingen. Rollen werden<br />
durch Erwartungen <strong>und</strong> Normen definiert, <strong>Geschlecht</strong>srollen durch die Verknüpfung<br />
der Erwartungen mit dem biologischen Status. Es gibt hier nichts,<br />
was eine Analyse von Macht erforderlich machen würde. Andererseits gibt es<br />
in der <strong>Geschlecht</strong>srollenforschung eine gr<strong>und</strong>legende Tendenz, die Stellung<br />
von Frauen <strong>und</strong> Männern als komplementär aufzufassen - was Parsons'<br />
Theorie ausdrückt als instrumentelle (männliche) <strong>und</strong> expressive (weibliche)<br />
Orientierung.<br />
Wenn es in einem Rollensystem so etwas wie Unterdrückung gibt, ist es<br />
der Druck, den die Rolle auf das Ich ausübt. Das kann aber bei der männlichen<br />
Rolle genauso passieren wie bei der weiblichen. Diese Art von Druck<br />
war tatsächlich zentrales Thema in den Männerbüchern der 70er Jahre. Sie<br />
waren voller Anekdoten über den Würgegriff von Sportreportern, schweigsamen<br />
Väter <strong>und</strong> prahlerischen Peer-groups, dem sich die männliche Jugend<br />
des Landes ausgesetzt sah.<br />
Als Pleck 1981 eine Überblicksstudie zur Männerrollenforschung veröffentlichte<br />
(„The Myth of Masculinity"), stand dabei dieses Verhältnis von<br />
Rolle <strong>und</strong> Selbst im Mittelpunkt. Er kritisierte das Paradigma der „Männer<br />
rollenidentität" (wie er die funktionalistische <strong>Geschlecht</strong>srollentheorie<br />
nannte) vor allem, weil sie von einer Übereinstimmung von Norm <strong>und</strong> Persönlichkeit<br />
ausging <strong>und</strong> davon, daß Konformität mit den Normen der <strong>Geschlecht</strong>srolle<br />
das psychische Gleichgewicht fördert.<br />
Diese Kritik war sehr stichhaltig. Pleck zeigte, wieviel beim Diskurs der<br />
funktionalistischen <strong>Geschlecht</strong>srolle einfach vorausgesetzt wird, <strong>und</strong> wie<br />
spärlich die empirische Absicherung der zentralen Annahmen ist. Fast noch<br />
interessanter war ein beinah Focaultsches Argument Plecks: Die normative<br />
<strong>Geschlecht</strong>srollentheorie sei an sich schon eine Form von <strong>Geschlecht</strong>erpolitik.<br />
Die historischen Veränderungen des <strong>Geschlecht</strong>erverhältnisses würden<br />
auch eine andere Art der sozialen Kontrolle notwendig machen: interne statt<br />
externe Kontrollmechanismen.<br />
„Das Konzept der <strong>Geschlecht</strong>rollenidentität hält das Individuum, das die traditionellen<br />
Rollennormen verletzt, davon ab, sie in Frage zu stellen; statt dessen fühlen sie sich persönlich<br />
unzureichend <strong>und</strong> verunsichert." "L<br />
Die normative <strong>Geschlecht</strong>srollentheorie lähmt insofern sozialen Wandel.<br />
Als Alternative schlug Pleck eine nicht-normative <strong>Geschlecht</strong>srollentheorie<br />
vor, die zwischen Selbst <strong>und</strong> Rolle unterscheidet. Er stellte sich eine Männerrolle<br />
vor, die es erlauben würde, Rollenkonformität unter Umständen als psychisch<br />
dysfunktional zu betrachten; bei der die Rollennormen veränderlich<br />
wären, <strong>und</strong> sich manchmal sogar ändern müßten; <strong>und</strong> wo viele diese Normen<br />
42 Pleck 1981 (S.160).<br />
4 4<br />
mißachten würden <strong>und</strong> dafür mit Sanktionen zu rechnen hätten, aber auch<br />
genauso viele sich übermäßig konform verhalten würden.<br />
In dieser Form wäre das Konzept der Männerrolle konsistenter <strong>und</strong> würde<br />
die Reste biologischen Determinismus <strong>und</strong> Identitätstheorie abschütteln.<br />
Aber die intellektuellen Beschränkungen der Rollenperspektive wären damit<br />
noch nicht durchbrochen.<br />
Diese Beschränkungen sind wiederholt nachgewiesen worden." Weil die<br />
Rollentheorie fast einmütig diese Kritik ignorierte, <strong>und</strong> weil der Begriff<br />
„Männerrolle" noch immer in aller M<strong>und</strong>e ist, werde ich trotzdem auf die<br />
wichtigsten Einwände eingehen.<br />
Die Rollentheorie ist logisch nicht sehr eindeutig. Ein <strong>und</strong> derselbe Begriff<br />
soll einen Beruf beschreiben, einen politischen Status, eine vorübergehende<br />
Verlaufsform, ein Hobby, einen Lebensabschnitt <strong>und</strong> ein <strong>Geschlecht</strong>.<br />
Wegen der wechselnden Gr<strong>und</strong>lagen, nach denen Rollen definiert werden,<br />
führt die Rollentheorie bei der Analyse des sozialen Lebens zu beträchtlichen<br />
Inkohärenzen. Die Rollentheorie übertreibt das Ausmaß, in dem das soziale<br />
Verhalten der Menschen vorgeordnet ist. Aber gleichzeitig untertreibt sie soziale<br />
Ungleichheit <strong>und</strong> Macht, indem sie von wechselseitigen Erwartungszwängen<br />
ausgeht. Aus all diesen Gründen hat sich das Konzept der „Rolle"<br />
für eine soziale Analyse als unbrauchbar erwiesen.<br />
Das heißt aber nicht, daß „Rolle" als dramaturgische Metapher für das<br />
Verständnis sozialer Situationen gänzlich nutzlos wäre. Sie eignet sich für<br />
Situationen, in denen (a) nach gut definierten Skripts gehandelt wird, (b) es<br />
klare Adressaten des Verhaltens gibt <strong>und</strong> (c) nicht zu viel auf dem Spiel steht<br />
(damit eine Art Inszenierung die hauptsächliche soziale Aktivität darstellen<br />
kann).<br />
Keine diese Voraussetzungen ist bei Beziehungen zwischen den <strong>Geschlecht</strong>ern<br />
ge<strong>geben</strong>. „<strong>Geschlecht</strong>srolle ° ist deshalb eine gr<strong>und</strong>sätzlich ungeeignete<br />
Metapher für geschlechtsbezogene Interaktionen. (Man könnte frei<br />
lich an spezifische Situationen geschlechtsbezogener Interaktion denken, wo<br />
definitiv Rollen gespielt werden. Standardtanzwettbewerbe kommen einem<br />
in den Sinn - wie in dem bezaubernden Film „Strictly Baliroom".)<br />
In der <strong>Geschlecht</strong>srollentheorie wird Handeln (die Inszenierung einer<br />
Rolle) auf eine Struktur bezogen, die auf biologischen Unterschieden - der<br />
Unterscheidung in männlich <strong>und</strong> weiblich -, statt auf sozialen Beziehungen<br />
beruht. Die Gleichsetzung von <strong>Geschlecht</strong>sunterschieden mit <strong>Geschlecht</strong>srollen<br />
führt zu einem Kategoriendenken, bei dem das soziale <strong>Geschlecht</strong> auf<br />
zwei homogene Kategorien reduziert wird. <strong>Geschlecht</strong>srollen sind als komplementär<br />
definiert <strong>und</strong> Polarisierung ist ein notwendiger Teil des Konzepts.<br />
43 Über das Rollenkonzept allgemein, siehe Urry 1970, Coulson 1972, <strong>und</strong> Connell<br />
1979. Zur <strong>Geschlecht</strong>srollentheorie siehe Edwards 1983, Stacey <strong>und</strong> Thorne 1985.<br />
Ihre Anwendung in der Männerforschung wurde kritisiert von Carrigan et al. 1985,<br />
Kimmel 1987.<br />
45