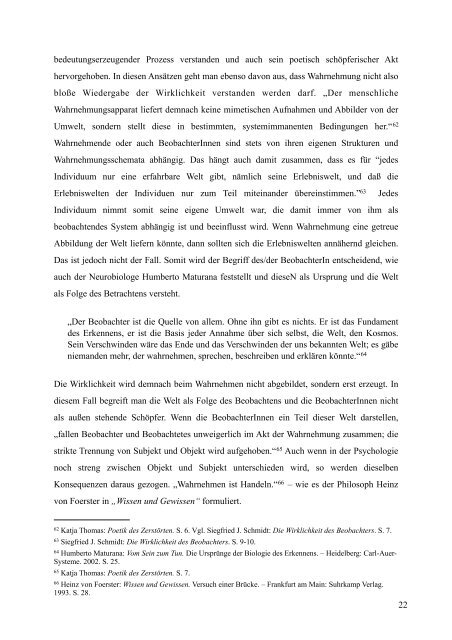DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
edeutungserzeugender Prozess verstanden und auch sein poetisch schöpferischer Akt<br />
hervorgehoben. In diesen Ansätzen geht man ebenso davon aus, dass Wahrnehmung nicht also<br />
bloße Wiedergabe der Wirklichkeit verstanden werden darf. „Der menschliche<br />
Wahrnehmungsapparat liefert demnach keine mimetischen Aufnahmen und Abbilder von der<br />
Umwelt, sondern stellt diese in bestimmten, systemimmanenten Bedingungen her.“ 62<br />
Wahrnehmende oder auch BeobachterInnen sind stets von ihren eigenen Strukturen und<br />
Wahrnehmungsschemata abhängig. Das hängt auch damit zusammen, dass es <strong>für</strong> “jedes<br />
Individuum nur eine erfahrbare Welt gibt, nämlich seine Erlebniswelt, und daß die<br />
Erlebniswelten der Individuen nur zum Teil miteinander übereinstimmen.” 63 Jedes<br />
Individuum nimmt somit seine eigene Umwelt war, die damit immer von ihm als<br />
beobachtendes System abhängig ist und beeinflusst wird. Wenn Wahrnehmung eine getreue<br />
Abbildung der Welt liefern könnte, dann sollten sich die Erlebniswelten annähernd gleichen.<br />
Das ist jedoch nicht der Fall. Somit wird der Begriff des/der BeobachterIn entscheidend, wie<br />
auch der Neurobiologe Humberto Maturana feststellt und dieseN als Ursprung und die Welt<br />
als Folge des Betrachtens versteht.<br />
„Der Beobachter ist die Quelle von allem. Ohne ihn gibt es nichts. Er ist das Fundament<br />
des Erkennens, er ist die Basis jeder Annahme über sich selbst, die Welt, den Kosmos.<br />
Sein Verschwinden wäre das Ende und das Verschwinden der uns bekannten Welt; es gäbe<br />
niemanden mehr, der wahrnehmen, sprechen, beschreiben und erklären könnte.“ 64<br />
Die Wirklichkeit wird demnach beim Wahrnehmen nicht abgebildet, sondern erst erzeugt. In<br />
diesem Fall begreift man die Welt als Folge des Beobachtens und die BeobachterInnen nicht<br />
als außen stehende Schöpfer. Wenn die BeobachterInnen ein Teil dieser Welt darstellen,<br />
„fallen Beobachter und Beobachtetes unweigerlich im Akt der Wahrnehmung zusammen; die<br />
strikte Trennung von Subjekt und Objekt wird aufgehoben.“ 65 Auch wenn in der Psychologie<br />
noch streng zwischen Objekt und Subjekt unterschieden wird, so werden dieselben<br />
Konsequenzen daraus gezogen. „Wahrnehmen ist Handeln.“ 66 – wie es der Philosoph Heinz<br />
von Foerster in „Wissen und Gewissen“ formuliert.<br />
62 Katja Thomas: Poetik des Zerstörten. S. 6. Vgl. Siegfried J. Schmidt: Die Wirklichkeit des Beobachters. S. 7.<br />
63 Siegfried J. Schmidt: Die Wirklichkeit des Beobachters. S. 9-10.<br />
64 Humberto Maturana: Vom Sein zum Tun. Die Ursprünge der Biologie des Erkennens. – Heidelberg: Carl-Auer-<br />
Systeme. 2002. S. 25.<br />
65 Katja Thomas: Poetik des Zerstörten. S. 7.<br />
66 Heinz von Foerster: Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.<br />
1993. S. 28.<br />
22