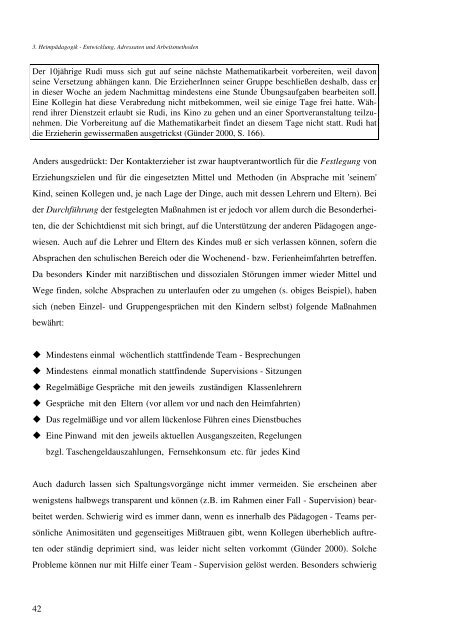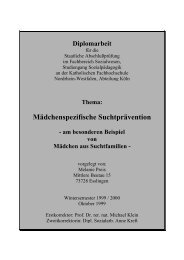1 TEIL KAPITEL & Abschnitt 1. 4 5 5 6 3. 7 7 3.1.1 Die Entwicklung ...
1 TEIL KAPITEL & Abschnitt 1. 4 5 5 6 3. 7 7 3.1.1 Die Entwicklung ...
1 TEIL KAPITEL & Abschnitt 1. 4 5 5 6 3. 7 7 3.1.1 Die Entwicklung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>3.</strong> Heimpädagogik - <strong>Entwicklung</strong>, Adressaten und Arbeitsmethoden<br />
Der 10jährige Rudi muss sich gut auf seine nächste Mathematikarbeit vorbereiten, weil davon<br />
seine Versetzung abhängen kann. <strong>Die</strong> ErzieherInnen seiner Gruppe beschließen deshalb, dass er<br />
in dieser Woche an jedem Nachmittag mindestens eine Stunde Übungsaufgaben bearbeiten soll.<br />
Eine Kollegin hat diese Verabredung nicht mitbekommen, weil sie einige Tage frei hatte. Während<br />
ihrer <strong>Die</strong>nstzeit erlaubt sie Rudi, ins Kino zu gehen und an einer Sportveranstaltung teilzunehmen.<br />
<strong>Die</strong> Vorbereitung auf die Mathematikarbeit findet an diesem Tage nicht statt. Rudi hat<br />
die Erzieherin gewissermaßen ausgetrickst (Günder 2000, S. 166).<br />
Anders ausgedrückt: Der Kontakterzieher ist zwar hauptverantwortlich für die Festlegung von<br />
Erziehungszielen und für die eingesetzten Mittel und Methoden (in Absprache mit 'seinem'<br />
Kind, seinen Kollegen und, je nach Lage der Dinge, auch mit dessen Lehrern und Eltern). Bei<br />
der Durchführung der festgelegten Maßnahmen ist er jedoch vor allem durch die Besonderheiten,<br />
die der Schichtdienst mit sich bringt, auf die Unterstützung der anderen Pädagogen angewiesen.<br />
Auch auf die Lehrer und Eltern des Kindes muß er sich verlassen können, sofern die<br />
Absprachen den schulischen Bereich oder die Wochenend - bzw. Ferienheimfahrten betreffen.<br />
Da besonders Kinder mit narzißtischen und dissozialen Störungen immer wieder Mittel und<br />
Wege finden, solche Absprachen zu unterlaufen oder zu umgehen (s. obiges Beispiel), haben<br />
sich (neben Einzel- und Gruppengesprächen mit den Kindern selbst) folgende Maßnahmen<br />
bewährt:<br />
Mindestens einmal wöchentlich stattfindende Team - Besprechungen<br />
Mindestens einmal monatlich stattfindende Supervisions - Sitzungen<br />
Regelmäßige Gespräche mit den jeweils zuständigen Klassenlehrern<br />
Gespräche mit den Eltern (vor allem vor und nach den Heimfahrten)<br />
Das regelmäßige und vor allem lückenlose Führen eines <strong>Die</strong>nstbuches<br />
Eine Pinwand mit den jeweils aktuellen Ausgangszeiten, Regelungen<br />
bzgl. Taschengeldauszahlungen, Fernsehkonsum etc. für jedes Kind<br />
Auch dadurch lassen sich Spaltungsvorgänge nicht immer vermeiden. Sie erscheinen aber<br />
wenigstens halbwegs transparent und können (z.B. im Rahmen einer Fall - Supervision) bearbeitet<br />
werden. Schwierig wird es immer dann, wenn es innerhalb des Pädagogen - Teams persönliche<br />
Animositäten und gegenseitiges Mißtrauen gibt, wenn Kollegen überheblich auftreten<br />
oder ständig deprimiert sind, was leider nicht selten vorkommt (Günder 2000). Solche<br />
Probleme können nur mit Hilfe einer Team - Supervision gelöst werden. Besonders schwierig<br />
42