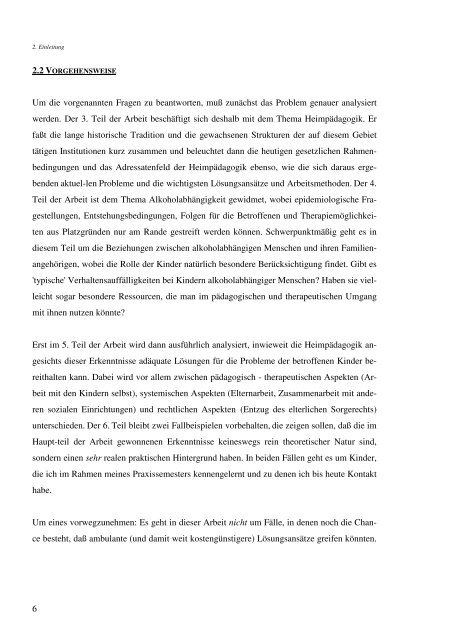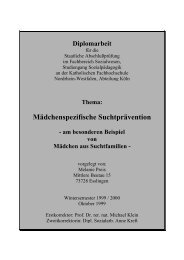1 TEIL KAPITEL & Abschnitt 1. 4 5 5 6 3. 7 7 3.1.1 Die Entwicklung ...
1 TEIL KAPITEL & Abschnitt 1. 4 5 5 6 3. 7 7 3.1.1 Die Entwicklung ...
1 TEIL KAPITEL & Abschnitt 1. 4 5 5 6 3. 7 7 3.1.1 Die Entwicklung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. Einleitung<br />
2.2 VORGEHENSWEISE<br />
Um die vorgenannten Fragen zu beantworten, muß zunächst das Problem genauer analysiert<br />
werden. Der <strong>3.</strong> Teil der Arbeit beschäftigt sich deshalb mit dem Thema Heimpädagogik. Er<br />
faßt die lange historische Tradition und die gewachsenen Strukturen der auf diesem Gebiet<br />
tätigen Institutionen kurz zusammen und beleuchtet dann die heutigen gesetzlichen Rahmenbedingungen<br />
und das Adressatenfeld der Heimpädagogik ebenso, wie die sich daraus ergebenden<br />
aktuel-len Probleme und die wichtigsten Lösungsansätze und Arbeitsmethoden. Der 4.<br />
Teil der Arbeit ist dem Thema Alkoholabhängigkeit gewidmet, wobei epidemiologische Fragestellungen,<br />
Entstehungsbedingungen, Folgen für die Betroffenen und Therapiemöglichkeiten<br />
aus Platzgründen nur am Rande gestreift werden können. Schwerpunktmäßig geht es in<br />
diesem Teil um die Beziehungen zwischen alkoholabhängigen Menschen und ihren Familienangehörigen,<br />
wobei die Rolle der Kinder natürlich besondere Berücksichtigung findet. Gibt es<br />
'typische' Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern alkoholabhängiger Menschen? Haben sie vielleicht<br />
sogar besondere Ressourcen, die man im pädagogischen und therapeutischen Umgang<br />
mit ihnen nutzen könnte?<br />
Erst im 5. Teil der Arbeit wird dann ausführlich analysiert, inwieweit die Heimpädagogik angesichts<br />
dieser Erkenntnisse adäquate Lösungen für die Probleme der betroffenen Kinder bereithalten<br />
kann. Dabei wird vor allem zwischen pädagogisch - therapeutischen Aspekten (Arbeit<br />
mit den Kindern selbst), systemischen Aspekten (Elternarbeit, Zusammenarbeit mit anderen<br />
sozialen Einrichtungen) und rechtlichen Aspekten (Entzug des elterlichen Sorgerechts)<br />
unterschieden. Der 6. Teil bleibt zwei Fallbeispielen vorbehalten, die zeigen sollen, daß die im<br />
Haupt-teil der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse keineswegs rein theoretischer Natur sind,<br />
sondern einen sehr realen praktischen Hintergrund haben. In beiden Fällen geht es um Kinder,<br />
die ich im Rahmen meines Praxissemesters kennengelernt und zu denen ich bis heute Kontakt<br />
habe.<br />
Um eines vorwegzunehmen: Es geht in dieser Arbeit nicht um Fälle, in denen noch die Chance<br />
besteht, daß ambulante (und damit weit kostengünstigere) Lösungsansätze greifen könnten.<br />
6