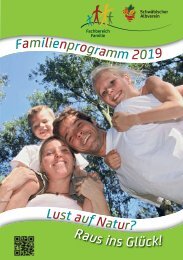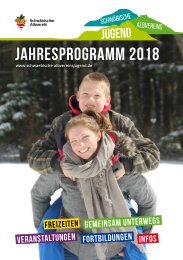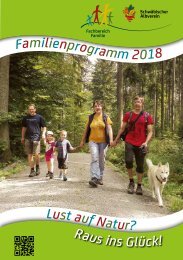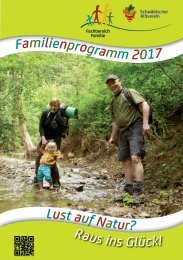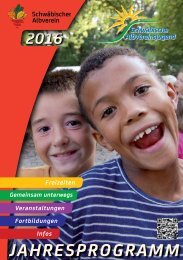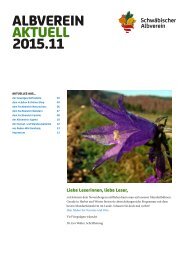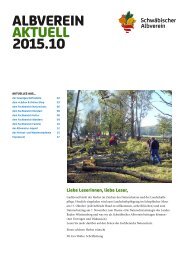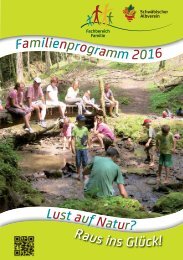Albvereinsblatt_2011-04.pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Invasoren der Vogelwelt<br />
Invasoren wird immer mit Skepsis begegnet. Bei diesen handelt<br />
es sich aber um solche, die ohne böse Absicht kommen. Es sind<br />
Invasoren auf Zeit von Oktober bis März. Sie haben auch nicht<br />
die hiesigen Artverwandten vertrieben, sondern sind wie diese<br />
vor drohendem Nahrungsmangel auf Wanderschaft geflogen.<br />
Mit den verbliebenen Vogelarten und üblichen Wintergästen besteht<br />
ein friedliches Nebeneinander. Auslöser dieser sich zu Invasionen<br />
zusammen ballenden Wanderschwärme können Mißernten<br />
ihrer Vorzugsnahrung im Brutgebiet und Übervermehrung<br />
in vorangegangenen Schlemmerjahren sein. Sie ziehen nach<br />
Süden, immer ihrer Lieblingsnahrung nach. Wenn bei uns der<br />
Samenansatz und der Beerenbehang der Bäume und Sträucher<br />
groß ist, bleiben sie, bis alles aufgezehrt ist. Es ist nicht die Kälte,<br />
die zum vorübergehenden Verlassen ihrer Brutheimat zwingt:<br />
39 – 44 °C Körpertemperatur und ein dichtes Federkleid halten<br />
warm. Es geht um den täglichen Nachschub an Kalorien, der diese<br />
kleinen Körper warm halten muss.<br />
Gemeint sind Vogelarten aus dem Norden und Nordosten<br />
Europas. Nur wenige Arten sind es, die plötzlich invasionsartig<br />
auftauchen. Der Bergfink steht an erster Stelle und erscheint am<br />
regelmäßigsten. Dann folgen Seidenschwanz, Fichtenkreuzschnabel,<br />
Birkenzeisig und Tannenhäher. Manchmal hat man<br />
diesen Eindruck auch von den Erlenzeisigen.<br />
Am bekanntesten sind die Einfälle der Bergfinken. Bei deren Massenzügen<br />
kann man tatsächlich von Invasionen sprechen. Vor<br />
allem die Bucheckern der großen Buchenwälder unseres Landes<br />
ermöglichen ihnen ein Überleben. Seidenschwänze halten sich<br />
an den Fruchtbehang Beeren tragender Bäume und Sträucher,<br />
Kurt Heinz Lessig<br />
Der starengroße, in Gruppen auftretende Seidenschwanz ist<br />
leicht an seinem Schopf zu erkennen.<br />
Fichtenkreuzschnäbel ernähren sich hauptsächlich von Fichtensamen.<br />
Sie brüten sogar im Winter bei uns, wenn der Zapfenbehang<br />
besonders groß ist.<br />
Ebenso hält sich der Tannenhäher, der in einer Unterart auftritt,<br />
an Baumsamen. Birkenzeisig und Erlenzeisig sind meist auf den<br />
Namen gebenden Bäumen anzutreffen, nehmen aber auch allerlei<br />
Unkrautsämereien.<br />
Wegen des unregelmäßigen Auftretens dieser Invasionsvögel –<br />
mit bei manchen Arten mehrjährigen Abständen – fallen kleine<br />
Schwärme wenig auf. Bergfinken, Seidenschwänze und Tannenhäher<br />
in größerer Anzahl aber doch, und sie bringen es dann<br />
sogar bis auf die Lokalseiten der Zeitungen. Für den Vogelfreund<br />
zählt ihr Erscheinen zu den besonderen Naturerlebnissen: Es<br />
zeigt sich daran die erstaunliche Überlebensstrategie dieser gefiederten<br />
Mitgeschöpfe.<br />
Schwäbische Pflanzennamen<br />
von Prof. Dr. Theo Müller<br />
Busch-Windröschen (Anemone nemorosa)<br />
Das Busch-Windröschen gehört als Frühjahrsblüher zu den<br />
bekanntesten Blumen, wurde aber von den alten Botanikern<br />
kaum beachtet, da es bei den antiken Ärzten keine<br />
Rolle spielte und auch sonst in der Heilkunde kaum verwendet<br />
wurde. Es kommt verbreitet, oft in großen Herden<br />
den Boden deckend, auf mehr oder weniger nährstoffreichen,<br />
mäßig trockenen bis frischen Böden in Laubmischwäldern<br />
vor, in höheren Lagen (bis 2000 m über NN) vor allem<br />
in Wiesen. Mit dem waagrecht kriechenden, meist verzweigten<br />
Wurzelstock erreicht es Bodentiefen bis 15 cm. Das<br />
Hahnenfußgewächs wird 10 –25 cm hoch. Der Stängel weist<br />
im oberen Drittel einen Quirl von 1 –3 cm lang gestielten,<br />
dreiteiligen Blättern auf. Die einzeln stehenden, 2 –3 cm großen<br />
sternförmigen Blüten bestehen aus sechs bis acht weißen,<br />
oft rötlich überlaufenen Blütenblättern, zahlreichen gelben<br />
Staubgefäßen und Fruchtknoten.<br />
Wegen seiner Bekanntheit gibt es für das Busch-Windröchen<br />
zahlreiche Volksnamen, wobei hier nur die schwäbischen<br />
berücksichtigt werden. Der Name »Windröschen« geht<br />
darauf zurück, dass die Blüten auf ihren dünnen Stielen bei<br />
Wind hin- und herschwanken. Auf die weiße Blütenfarbe beziehen<br />
sich Namen wie Eierbluem, Mehlblümle oder Beckabueb.<br />
In diesen Bezug sind auch die Namen Schneeflock<br />
41<br />
Gelbes Windröschen<br />
und Schneekätter einzubeziehen, weil dichte Bestände im<br />
Frühjahrswald an Schnee erinnern. Andere Namen orientieren<br />
sich nach der Blütenform (Sternebluem), nach der frühen<br />
Blütezeit (Märzeblümle, Aprila) oder nach Tierarten als<br />
Frühlingsboten (Hasebluem, Guguckle oder Guggichbluem).<br />
Die Bezeichnung Waldhähnle, Weißer Gockeler oder Güg-<br />
Thomas Pfündel