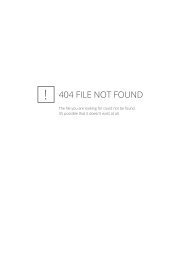Theodor W. Adorno / Max Horkheimer - Dialektik der Aufklärung zur ...
Theodor W. Adorno / Max Horkheimer - Dialektik der Aufklärung zur ...
Theodor W. Adorno / Max Horkheimer - Dialektik der Aufklärung zur ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ausgetrieben, auch und gerade wo man historische Sujets auskramt. Historie selber wird zum Kostüm<br />
gleich dem Individuum: die gefrorene Mo<strong>der</strong>ne von Monopol und Staatskapitalismus versteckt sich<br />
darin. So gerät die falsche Versöhnung, nämlich das Einziehen jeglicher negativen Gegeninstanz<br />
durchs allmächtige Dasein, die Abschaffung <strong>der</strong> Dissonanz durch die Totalität des Schlechten. Die<br />
Konfliktlosigkeit innerhalb <strong>der</strong> Kunstwerke bekräftigt, daß sie keinen Konflikt zum Leben draußen mehr<br />
austragen, weil das Leben die Konflikte selber in die tiefsten Höhlen des Leidens verbannt und mit<br />
mitleidslosem Druck unsichtbar hält. Die ästhetische Wahrheit war gebunden an den Ausdruck <strong>der</strong><br />
Unwahrheit <strong>der</strong> bürgerlichen Gesellschaft. Eigentlich gibt es gerade nur so viel Kunst wie Kunst<br />
unmöglich ist kraft <strong>der</strong> Ordnung, die sie transzendiert. Darum ist die Existenz all ihrer großen Formen<br />
paradox und mehr als alle an<strong>der</strong>en die des Romans, <strong>der</strong> bürgerlichen Form %xaT' %eboxqv, <strong>der</strong>en<br />
dann <strong>der</strong> Film sich bemächtigt hat. Heute ist mit dem äußersten Anwachsen <strong>der</strong> Spannung die<br />
Möglichkeit <strong>der</strong> Kunstwerke selber ganz fragwürdig geworden. Das Monopol ist <strong>der</strong> Nachrichter: es<br />
löscht die Spannung aus, aber mit den Konflikten schafft es die Kunst ab. Erst in <strong>der</strong> vollendeten<br />
Konfliktlosigkeit wird diese ganz und gar zu einer Abteilung <strong>der</strong> materiellen Produktion und damit<br />
vollends zu <strong>der</strong> Lüge, zu <strong>der</strong> sie stets schon ihr Scherflein beigetragen hat. Zugleich aber kommt sie<br />
<strong>der</strong> Wahrheit wie<strong>der</strong> näher als was an traditioneller Kunst weiter gedeiht, insofern als jede<br />
Konservierung des individuellen Konflikts im Kunstwerk, und meist selbst die Einführung des sozialen,<br />
dem romantischen Schwindel dient, und die Welt als eine möglichen Konflikts noch vergoldet<br />
gegenüber <strong>der</strong>, in welcher die allmächtige Produktion jene Möglichkeit sichtbarer stets zu verdrängen<br />
beginnt. Es liegt an <strong>der</strong> feinsten Differenz, ob die Liquidation des ästhetischen Knotens, <strong>der</strong><br />
Durchführung, des Konflikts die Liquidation des letzten Wi<strong>der</strong>stands bedeutet o<strong>der</strong> das Medium von<br />
dessen geheimer Allgegenwart.<br />
»So etwas tut man doch nicht«, sagt <strong>der</strong> smarte Gerichtsrat Brack, als Hedda Gabler sich erschießt.<br />
Seinen Standpunkt nimmt das Monopol ein. Es entzaubert Individuum und Konflikt durch Sachlichkeit.<br />
Die Allgegenwart <strong>der</strong> Technologie prägt sich den Gegenständen auf und tabuiert das Geschichtliche,<br />
die Spur vergangenen Leidens an Menschen und Dingen, als Kitsch. Prototypisch ist die<br />
Schauspielerin, die noch in den schrecklichsten Gefahren, im tropischen Taifun und in <strong>der</strong> Gewalt des<br />
Mädchenhändlers, frisch gebadet, sorgfältig geschminkt und makellos frisiert einherschreitet. Sie wird<br />
so scharf, genau und unerbittlich photographiert, daß <strong>der</strong> Zauber, den ihr make-up ausüben soll,<br />
durch die Illusionslosigkeit sich erhöht, mit dem er als buchstäblich wahrer und unübertriebener den<br />
Zuschauer anspringt. Massenkultur ist ungeschminkte Schminke. Mehr als mit allem an<strong>der</strong>en<br />
assimiliert sie sich dem Reich <strong>der</strong> Zwecke durch den nüchternen Blick. Die neue Sachlichkeit, die sie<br />
äfft, ist in <strong>der</strong> Architektur entwikelt worden. Sie hat in <strong>der</strong>en Zweckbereich das ästhetische Recht des<br />
Zweckmäßigen gegen die Barbarei vertreten, die <strong>der</strong> Schein des Zwecklosen dort mit sich bringt. Sie<br />
hat Standardisierung und Massenproduktion <strong>zur</strong> Sache <strong>der</strong> Kunst gemacht, wo <strong>der</strong>en Gegenteil zum<br />
Hohn wird aufs Formgesetz, das von draußen stammt. Um so schöner ist das Praktische, je mehr es<br />
auf den Schein von Schönheit verzichtet. Sobald aber Sachlichkeit von den Zwecken losgerissen wird,<br />
entartet sie zu eben jenem Ornament, das sie zu Beginn als Verbrechen denunziert hat. Gerade wo<br />
Film und Radio in technokratischen Visionen und utopistischen Verfahrungsweisen sich überschlagen,<br />
sind sie von <strong>der</strong> Art, wie die avancierte Architektur, ehe sie ihren Frieden mit <strong>der</strong> Welt machte, als<br />
unaufrichtig am leidenschaftlichsten sie bekämpfte. Wollte man die Serienkompositionen von Tin Pan<br />
Alley mit Architektur vergleichen, so dürfte man nicht an die neusachlichen Serienbauten denken,<br />
son<strong>der</strong>n vielmehr an jene Einfamilienhäuser, die Alt- und Neuengland anfüllen: standardisierte<br />
Massenprodukte, die gerade den Anspruch standardisieren, daß jegliches Haus unverwechselbar,<br />
unique, eine Villa sei. Nicht die Standardisierung als solche macht jene Häuser aus dem neunzehnten<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t heute so gespenstisch, son<strong>der</strong>n die unablässige Wie<strong>der</strong>holung des Unwie<strong>der</strong>holbaren,<br />
von Säulchen, Erkern, Treppchen und Türmchen. Jedem Produkt <strong>der</strong> Massenkultur läßt diese<br />
Mo<strong>der</strong>atmosphäre in seiner Jugendblüte schon sich anmerken, und <strong>der</strong> vom Monopol dirigierte<br />
Verschleiß macht sie von Jahr zu Jahr sichtbarer. Massenkultur ist mit ihrer eigenen Sachlichkeit<br />
inkompatibel. Sie bezieht sich stets auf Stoffe <strong>zur</strong>ück, <strong>der</strong>en Intention <strong>der</strong> sachlichen Schaustellung<br />
opponiert, während sie ihren Zusammenhang mit <strong>der</strong> herrschenden Praxis vorab durch die<br />
Entlehnung industrieller Methoden demonstriert, aus denen sie Sachlichkeit als Stil bereitet. Das<br />
Verhältnis von Sachlichkeit und Sache ist außersachlich: es wird von <strong>der</strong> Kalkulation bestimmt und<br />
gestört. Die Vollkommenheit des technologischen Wie, <strong>der</strong> Präsentation, des Tricks bei unabdingbarer<br />
Nichtigkeit des Was ist dafür <strong>der</strong> oberste Ausdruck. Die Virtuosität <strong>der</strong> Jazzband, die sich in den<br />
Achttaktern des Schlagerkomponisten ergeht wie ein Raubtier im Käfig, die Einstellungskünste <strong>der</strong><br />
Kamera, welche die seelenvollen Wolkeneffekte von Romanen aus dem neunzehnten Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
beliebig hervorbringen, die frequency modulation, die in verwegener Klarheit das Ave Maria von<br />
Gounod zu hören erlaubt- all das ist keine bloße Lücke zwischen ungleichzeitigen Momenten <strong>der</strong><br />
Entwicklung, son<strong>der</strong>n die Ungleichzeitigkeit selber entspringt aus dem zwangshaften quid pro quo von<br />
Traum und Zweck in <strong>der</strong> Massenkultur, so wie die neudeutschen Volkstrachten und Tänze nicht trotz