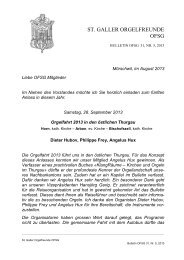Franz Lüthi - OFSG - St. Galler Orgelfreunde
Franz Lüthi - OFSG - St. Galler Orgelfreunde
Franz Lüthi - OFSG - St. Galler Orgelfreunde
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
35<br />
diverse Problempunkte erahnen; Begeisterung spricht nicht daraus.<br />
Trotz vieler übernommener Register sei das Instrument mit seinen 57<br />
Registern (wohl inkl. Auszügen und Transmissionen) als ein neues Werk<br />
zu betrachten. Die Orgel besass einen Hauptprospekt mit einfachem<br />
Untergehäuse, der vom grössten Teil des Schiffes aus nicht sichtbar war<br />
und schon beim Neubau als Provisorium galt.<br />
Anlässlich der Kirchenrenovation 1933 baute man die Orgel aus und<br />
ergänzte sie beim Wiedereinbau durch ein Rückpositiv mit 7 Registern<br />
an der Emporenbrüstung. Die Orgel erhielt kein weiteres Manual. Das<br />
neue Rückpositiv konnte vom II. Manual aus gespielt werden, wobei die<br />
bestehende Lade des II. Manuals und die neue Rückpositiv-Lade durch<br />
zwei neue Absteller getrennt ein- und ausgeschaltet werden konnten (II<br />
ab und RP ab).<br />
Zum Jahresende 1933 lobte Musikdirektor Schenk die Grosszügigkeit des <strong>St</strong>immbürgers<br />
zugunsten der Orgelerweiterung und erwähnte in diesem Brief auch eindeutige<br />
Registerzahlen: I. Man. 14 / II. 12 / III. 15 (= Fernwerk) / Rückpositiv 7<br />
Register / Pedal 9 Register. Das wären trotz Erweiterung nur 57 Register, also die<br />
gleiche Anzahl wie 1925. Die Zählung von 1925 ist daher anzuzweifeln; auch bei<br />
Berücksichtigung der damaligen nichtklingenden Register geht die Rechnung nicht<br />
auf.<br />
1954 stellte die Firma Kuhn in einem Zustandsbericht fest, dass die<br />
Orgel unpräzise sei. Die Verzögerungen in der pneumatischen Traktur<br />
seien überdies unterschiedlich im Fernwerk (III. Manual) auf dem Estrich<br />
und im Rückpositiv an der Brüstung. Offenbar diskutierte man eine Verbesserung<br />
durch Umstellung auf elektrische Traktur. Orgelexperte Siegfried<br />
Hildenbrand sprach 1963 von einem überdimensionierten Harmonium.<br />
Nicht nur das Fernwerk im Estrich, sondern auch der <strong>St</strong>andort der<br />
Orgel auf der oberen Empore sei wegen der zu geringen Raumhöhe<br />
ungünstig. Eine neue Orgel solle unbedingt auf die untere Empore zu<br />
stehen kommen.<br />
Auf dem Weg zur neuen Mathis-Orgel<br />
Nachdem Musikdirektor Wirz 1970 einmal mehr auf den schlechten<br />
Zustand der Orgel und die <strong>St</strong>örungen aufmerksam machte, holte man<br />
Kostenvoranschläge ein für einen Neubau bei Orgelbau Graf, Sursee,<br />
und Späth, Rapperswil. Eine Orgelexpertise durch Josef Holtz am<br />
16.10.1973 kam zu folgendem Ergebnis (in der damaligen, teils "orgelbewegen"<br />
Ausdrucksweise): Das Klangbild dieser Orchesterorgel von<br />
1925 habe mit einem "echten strahlenden Orgelklang" nichts gemeinsam.<br />
Wenn auch nicht mehr so "dekadent" wie frühere Instrumente aus<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
<strong>St</strong>. <strong>Galler</strong> <strong>Orgelfreunde</strong> <strong>OFSG</strong> Bulletin <strong>OFSG</strong> 31, Nr. 1, 2013