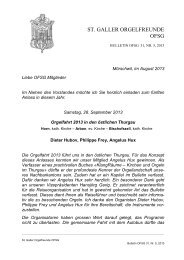Franz Lüthi - OFSG - St. Galler Orgelfreunde
Franz Lüthi - OFSG - St. Galler Orgelfreunde
Franz Lüthi - OFSG - St. Galler Orgelfreunde
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5<br />
Zusammenfassung:<br />
Orgel und Orgelmusik<br />
in Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert<br />
Charakteristisch für Frankreichs Orgelmusik im 17. und 18. Jahrhundert<br />
ist eine enge Verflechtung des Orgelbaus mit den musikalischen Formen<br />
und ihrem Gebrauch im Gottesdienst. Unter dem Einfluss flämischer<br />
Orgelbauer entwickelte Jehan Titelouze in Rouen als einer der Pioniere<br />
um 1600 einen prägenden Orgeltyp, der auch inspirierend wirken sollte<br />
auf neue Kompositionen: Ein Instrument mit reichen Klangfarben, einer<br />
Vielfalt von Soloregistern, insbesondere Zungenstimmen und Cornet, mit<br />
polyphoner Transparenz und dialogisierendem Kontrast zwischen den<br />
beiden Hauptmanualen. Typisch war ein dagegen eher spärlich ausgestattetes<br />
Pedal, das immerhin konstant mit einer Trompette 8' besetzt<br />
war. Um 1630 wurde dieser Orgeltyp erweitert durch ein III. Manual<br />
(Récit oder stattdessen Écho), das im Diskant ebenfalls eine Cornet-<br />
Registrierung ermöglichte. Das erste Orgelbuch von G.G. Nivers 1665<br />
läutete sozusagen die Blütezeit der klassischen Orgel ein, die rund 70<br />
Jahre dauern sollte. Nivers zeigte paradigmatisch die neuen Klangtypen<br />
und belegte damit die enge Verflechtung von Orgelbau, Registrierpraxis<br />
und Liturgie. Alle grossen Instrumente besassen nun vier Manuale:<br />
Positif und Grand-Orgue, Récit, Écho und Pedal. Sie waren reich ausgestattet<br />
mit Aliquoten, Cornet- und Zungenregistern, wie sie in den Registriervorschriften<br />
der Livres d'Orgue vorgesehen waren. In der weiteren<br />
Entwicklung machte sich die Orgel von der liturgischen Alternatimpraxis<br />
und dem Cantus firmus zunehmend selbständig und bevorzugte neue<br />
Formen: Plein-jeu- und Grand-jeu-<strong>St</strong>ücke, Offertoires, die sich virtuos<br />
expandierten. Freie Orgelstücke, teilweise Suiten genannt, hatten den<br />
Vorteil, dass sie vielfältig verwendbar waren. Die Orgelmusik in der<br />
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts tendierte mehr zu Lautstärke und<br />
Orchesterimitation. Die nunmehr fünfmanualigen Orgeln erhielten ein<br />
eigenes Bombardenklavier und auch ein stärkeres Pedal.<br />
Im Weiteren werden die wichtigsten Begriffe zur französischen Orgelmusik<br />
sowie die wichtigsten Register erklärt und dazu einige zum Hören<br />
vielleicht hilfreiche Tipps gegeben. Ausführlich, aber vereinfachend,<br />
kommen die vielen Registriermöglichkeiten zur Sprache, zum Beispiel<br />
Plein jeu (Prinzipalplenum mit Mixturen), Plain Chant, Grundstimmenmischungen,<br />
Récits und andere Solo-Registrierungen sowie Dialogue<br />
sur les Grands jeux (Zungen-Kornettplenum ohne Prinzipalmixturen).<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
<strong>St</strong>. <strong>Galler</strong> <strong>Orgelfreunde</strong> <strong>OFSG</strong> Bulletin <strong>OFSG</strong> 31, Nr. 1, 2013