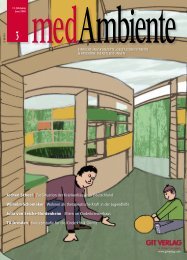E-Paper - GIT Verlag
E-Paper - GIT Verlag
E-Paper - GIT Verlag
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fachartikel<br />
Tributylzinn in Gesamtwasserproben<br />
Entwicklung eines Referenzverfahrens für die EU-Wasserrahmenrichtlinie<br />
Janine Richter, Ina Fettig, Christian Piechotta, Rosemarie Philipp und Norbert Jakubowski<br />
Organozinnverbindungen sind eine<br />
weitverbreitete Klasse von Umweltschadstoffen,<br />
die zur Belastung<br />
von Oberflächengewässern und der aquatischen<br />
Ökosysteme in den letzten Jahrzehnten<br />
beigetragen haben. Dabei weisen<br />
Organozinnverbindungen eine Vielfalt an<br />
physikalischen und chemischen Eigenschaften<br />
auf, die verschiedenste Einsatzmöglichkeiten<br />
in Industrie und Landwirtschaft<br />
ermöglichen.<br />
Der Eintrag in die Umwelt ist hauptsächlich<br />
anthropogenen Ursprungs. Am populärsten<br />
sind die Nutzung als Zusatz in Antifoulinganstrichen<br />
für Schiffe, Additive in Polymeren,<br />
Holzschutzmittel, Fungizide und<br />
Insektizide. Seit 2003 ist die bedeutendste<br />
Organozinnverbindung Tributylzinn (TBT)<br />
in Antifoulingfarben in der EU zwar verboten<br />
und auch andere Anwendungen sind<br />
beschränkt oder rückläufig, dennoch ist<br />
sie weitverbreitet und in Oberflächengewässern,<br />
Biota, Schlamm und Sedimenten<br />
nachweisbar.<br />
Folgen des Eintrags von TBT<br />
Es ist bekannt, dass Organozinnverbindungen<br />
und insbesondere TBT toxische Wirkung<br />
auf die aquatische Umwelt zeigen. Aufgrund<br />
seines hohen ökologischen Schädigungspotentials<br />
zählt TBT zu den stärksten bekannten<br />
Umweltgiften. Schon im unteren ppt-<br />
Bereich führt TBT zu akuten Vergiftungen<br />
von Algen, Weichtieren wie Muscheln und<br />
Fischlarven. Als Folge einer TBT-Belastung<br />
kommt es unter anderem zu Schalendeformationen,<br />
DNA-Schädigung, Beeinträchtigung<br />
der Geschlechtsbildung und des<br />
Wachstums. Auch das Imposex-Phänomen,<br />
bei dem das Geschlecht gegensätzlich zum<br />
bestehenden verändert wird, ist eine Folge<br />
des Kontakts der Weichtiere mit TBT. Das<br />
Umweltgift greift dabei in das Hormonsystem<br />
von Schnecken und Austern ein. TBT<br />
ist die bisher einzig bekannte androgen<br />
wirkende Substanz, d. h. es kann zu einer<br />
Vermännlichung von weiblichen Schnecken<br />
kommen.<br />
Für den Menschen stellen die Zinnverbindungen<br />
ebenfalls eine Gefahr dar, da sie<br />
durch Akkumulation in den aquatischen<br />
Lebewesen in die Nahrungskette gelangen<br />
können. Auch die Kontamination von<br />
Trinkwasser ist eine mögliche Quelle zur<br />
Aufnahme der Schadstoffe. Akute Vergiftungen<br />
durch Tributylzinn können beim<br />
Menschen zu Atemnot, Herzversagen und<br />
Gehirnblutungen führen. Als Folge einer<br />
chronischen Aufnahme kann das menschliche<br />
Immunsystem geschädigt werden,<br />
dabei werden die Funktionen der Immunzellen<br />
gestört. Triorganozinnverbindungen<br />
verursachen bei Säugern zudem hämatologische<br />
Veränderungen und haben Effekte<br />
auf verschiedene endokrine Organe. Auch<br />
der Verdacht der Kanzerogenität besteht für<br />
Tributylzinn.<br />
Anforderungen an das Referenzverfahren<br />
Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)<br />
2000/60/EG ist eine gesetzgebende Richtlinie,<br />
deren angestrebtes Ziel der Schutz der<br />
Binnen- und Küstenwasserqualität innerhalb<br />
der Europäischen Union ist. Um die Wasserqualität<br />
zu überwachen und zu beurteilen,<br />
wurden prioritäre Schadstoffe und zugehörige<br />
Grenzwerte festgelegt. Für diese Umweltschadstoffe<br />
müssen vergleichbare und<br />
rückführbare Messwerte innerhalb Europas<br />
bereitgestellt werden um eine hohe Wasserqualität<br />
nach den Maßgaben der WRRL zu<br />
erreichen. Dies kann aber nur durch Referenzmethoden<br />
ermöglicht werden, die als<br />
Referenzpunkte für die Umsetzung einer<br />
rückführbaren Infrastruktur dienen.<br />
In einem europäischen Forschungsprojekt<br />
des European Metrology Research Programmes<br />
(EMRP) sollen solche analytische<br />
Methoden für die quantitative Bestimmung<br />
ausgewählter prioritärer Stoffe entwickelt<br />
und validiert werden. Diese müssen in der<br />
Lage sein, die geforderten geringen Umweltqualitätsnormen<br />
(UQN) der WRRL in Gesamtwasserproben<br />
von Grund-, Oberflächenund<br />
Küstenwasser bestimmen zu können.<br />
Das gemeinsame Forschungsprojekt ENV08<br />
„Traceable measurements for monitoring critical<br />
pollutants under the European Water<br />
Framework Directive 2000/60/EC” setzt seinen<br />
Fokus dafür auf die drei Analyten bzw.<br />
Analytgruppen: Tributylzinn (TBT), polybromierte<br />
Diphenylether (PBDE) und ausge-<br />
586 ▪▪▪ <strong>GIT</strong> Labor-Fachzeitschrift 9/2013 Element- & Spurenanalytik