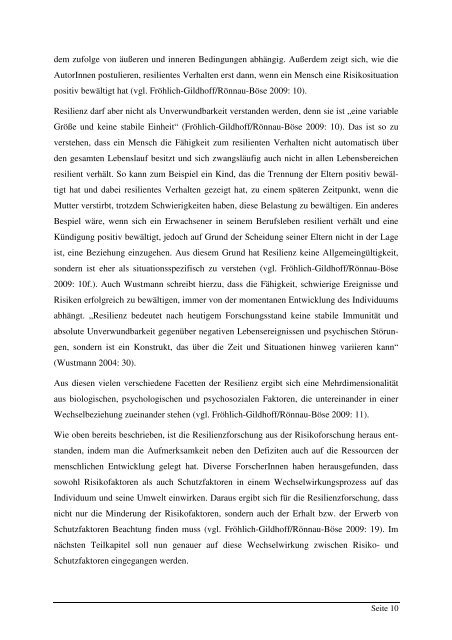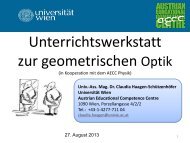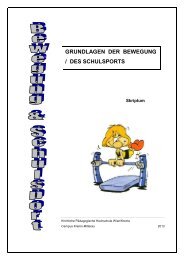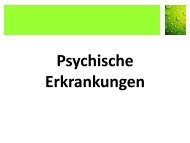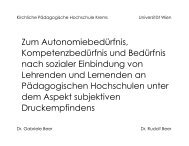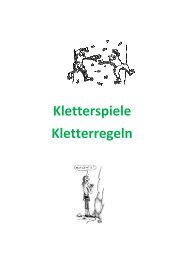Bachelorarbeit Hellmer und Burjan SoSe2013 - pro.kphvie.at
Bachelorarbeit Hellmer und Burjan SoSe2013 - pro.kphvie.at
Bachelorarbeit Hellmer und Burjan SoSe2013 - pro.kphvie.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
dem zufolge von äußeren <strong>und</strong> inneren Bedingungen abhängig. Außerdem zeigt sich, wie die<br />
AutorInnen postulieren, resilientes Verhalten erst dann, wenn ein Mensch eine Risikositu<strong>at</strong>ion<br />
positiv bewältigt h<strong>at</strong> (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2009: 10).<br />
Resilienz darf aber nicht als Unverw<strong>und</strong>barkeit verstanden werden, denn sie ist „eine variable<br />
Größe <strong>und</strong> keine stabile Einheit“ (Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2009: 10). Das ist so zu<br />
verstehen, dass ein Mensch die Fähigkeit zum resilienten Verhalten nicht autom<strong>at</strong>isch über<br />
den gesamten Lebenslauf besitzt <strong>und</strong> sich zwangsläufig auch nicht in allen Lebensbereichen<br />
resilient verhält. So kann zum Beispiel ein Kind, das die Trennung der Eltern positiv bewältigt<br />
h<strong>at</strong> <strong>und</strong> dabei resilientes Verhalten gezeigt h<strong>at</strong>, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die<br />
Mutter verstirbt, trotzdem Schwierigkeiten haben, diese Belastung zu bewältigen. Ein anderes<br />
Bespiel wäre, wenn sich ein Erwachsener in seinem Berufsleben resilient verhält <strong>und</strong> eine<br />
Kündigung positiv bewältigt, jedoch auf Gr<strong>und</strong> der Scheidung seiner Eltern nicht in der Lage<br />
ist, eine Beziehung einzugehen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> h<strong>at</strong> Resilienz keine Allgemeingültigkeit,<br />
sondern ist eher als situ<strong>at</strong>ionsspezifisch zu verstehen (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse<br />
2009: 10f.). Auch Wustmann schreibt hierzu, dass die Fähigkeit, schwierige Ereignisse <strong>und</strong><br />
Risiken erfolgreich zu bewältigen, immer von der momentanen Entwicklung des Individuums<br />
abhängt. „Resilienz bedeutet nach heutigem Forschungsstand keine stabile Immunität <strong>und</strong><br />
absolute Unverw<strong>und</strong>barkeit gegenüber neg<strong>at</strong>iven Lebensereignissen <strong>und</strong> psychischen Störungen,<br />
sondern ist ein Konstrukt, das über die Zeit <strong>und</strong> Situ<strong>at</strong>ionen hinweg variieren kann“<br />
(Wustmann 2004: 30).<br />
Aus diesen vielen verschiedene Facetten der Resilienz ergibt sich eine Mehrdimensionalität<br />
aus biologischen, psychologischen <strong>und</strong> psychosozialen Faktoren, die untereinander in einer<br />
Wechselbeziehung zueinander stehen (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2009: 11).<br />
Wie oben bereits beschrieben, ist die Resilienzforschung aus der Risikoforschung heraus entstanden,<br />
indem man die Aufmerksamkeit neben den Defiziten auch auf die Ressourcen der<br />
menschlichen Entwicklung gelegt h<strong>at</strong>. Diverse ForscherInnen haben herausgef<strong>und</strong>en, dass<br />
sowohl Risikofaktoren als auch Schutzfaktoren in einem Wechselwirkungs<strong>pro</strong>zess auf das<br />
Individuum <strong>und</strong> seine Umwelt einwirken. Daraus ergibt sich für die Resilienzforschung, dass<br />
nicht nur die Minderung der Risikofaktoren, sondern auch der Erhalt bzw. der Erwerb von<br />
Schutzfaktoren Beachtung finden muss (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2009: 19). Im<br />
nächsten Teilkapitel soll nun genauer auf diese Wechselwirkung zwischen Risiko- <strong>und</strong><br />
Schutzfaktoren eingegangen werden.<br />
Seite 10