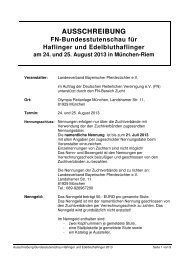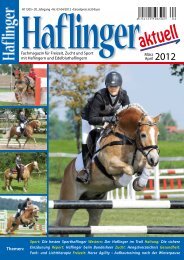Mai/Juni 2013 - Haflinger aktuell
Mai/Juni 2013 - Haflinger aktuell
Mai/Juni 2013 - Haflinger aktuell
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
der so genannten Freizeitpferde stellen und<br />
oftmals nicht ausreichend bewegt werden,<br />
um den Energieüberschuss zu kompensieren,<br />
was eine weitere Gewichtszunahme zur<br />
Folge hat. Dickleibigkeit beeinträchtigt den<br />
Gesamtstoffwechsel des Pferdes erheblich<br />
und leistet Stoffwechselerkrankungen wie<br />
der Hufrehe Vorschub.<br />
Fatales Fruktan<br />
Als Hauptauslöser der Grasrehe gilt heute<br />
Fruktan, ein durch kontinuierliche Saatgutveränderung<br />
vermehrt auftretendes<br />
langkettiges Zuckermolekül, das dem Gras<br />
als Reservekohlenhydrat dient, um Ertragsverluste<br />
durch Dürre, Verbiss oder Frost zu<br />
vermeiden. Während Wiederkäuer keine<br />
Probleme mit diesem Mehrfachzucker haben,<br />
können Pferde Fruktan im Dünndarm<br />
nicht ausreichend verarbeiten. Dadurch<br />
gelangt es in den Dickdarm, wo es durch<br />
Übersäuerung des Darminhalts ein massenhaftes<br />
Absterben nützlicher und notwendiger<br />
Mikroben verursacht.<br />
Haltung<br />
Die Folge: Es bilden sich<br />
körpereigene Giftstoffe<br />
(Endotoxine), die über die<br />
Darmwand in den Blutkreislauf<br />
geraten und in<br />
den fein verzweigten Kapillaren<br />
der Huflederhaut<br />
eine Mangeldurchblutung<br />
mit nachfolgender Entzündung<br />
auslösen.<br />
Um die krankmachende<br />
Dosis von 7,5 Gramm<br />
Fruktan pro Kilogramm<br />
Körpergewicht zu erreichen,<br />
müsste ein Pferd<br />
zwar das Drei- bis Vierfache<br />
der durchschnittlichen<br />
Tagesmenge an Gras aufnehmen,<br />
allerdings führte der australische Hufreheforscher<br />
Prof. Chris Pollitt diesen Nachweis<br />
an gesunden Pferden durch. Vermutlich genügt<br />
bei Pferden, die bereits einmal Hufrehe<br />
hatten, eine weitaus geringere Menge<br />
Fruktan, um einen erneuten Hufreheschub<br />
auszulösen. Denn ist der Stoffwechsel erst<br />
mal aus dem Gleichgewicht und sind bereits<br />
Vorschädigungen am Hufbeinträger<br />
vorhanden, steigt erfahrungsgemäß die Reheanfälligkeit.<br />
Weil intensive Sonneneinstrahlung die<br />
Fruktananreicherung forciert, steigen die<br />
Fruktanwerte bis zum späten Nachmittag<br />
nach Aussagen zahlreicher Forscher stetig<br />
an, weshalb rehegefährdete Pferde bei<br />
dieser Wetterkonstellation rechtzeitig von<br />
der Weide geholt werden sollten. Bei bedecktem<br />
Himmel sinken die Fruktanwerte<br />
dagegen und sind nachts am niedrigsten,<br />
da bei Dunkelheit die hierfür notwendige<br />
Photosynthese fehlt. Nächtlicher Weidegang<br />
scheint also zumindest im Sommer<br />
eine echte Alternative für Pferde mit Reheneigung<br />
zu sein. Sicher verlassen kann man<br />
sich auf diese vielfach wissenschaftlich untermauerten<br />
Erkenntnisse über den Fruktangehalt<br />
im Gras jedoch nicht. Denn andere<br />
Untersuchungen zeigen andere Ergebnisse,<br />
was die Tagesschwankungen von Fruktangehalten<br />
im Weidegras betrifft. Grund<br />
hierfür scheinen multifaktorielle Einflüsse<br />
zu sein wie unterschiedliche Temperaturen,<br />
Nährstoff- und Wassergehalt des Weidebodens,<br />
Bodenstruktur (sandig, bindig),<br />
Lichtintensitäten sowie Fruktanreserven<br />
vom Vortag (Quelle: Dissertation „Fruktangehalt<br />
im Gras von Pferdeweiden während<br />
der Weisesaison“, TiHo Hannover). Vorsicht<br />
ist aber definitiv geboten, wenn im Frühjahr<br />
oder Herbst die Nachttemperaturen unter<br />
sechs Grad Celsius fallen. Denn dann legt<br />
das Gras einen Wachstumsstopp ein, sodass<br />
sich der Fruktanspeicher nicht weiter<br />
abbauen kann. Ein erhöhtes Reherisiko besteht<br />
vor allem bei leichten Bodenfrösten<br />
und Sonnenschein am Folgetag, während<br />
strenger Dauerfrost im Winter unbedenklich<br />
zu sein scheint. Bei Temperaturen ab<br />
minus zehn Grad Celsius verwandelt sich<br />
der Mehrfachzucker laut Kathryn Watts<br />
vom Grasforschungsinstitut Rocky Moun-<br />
Kräuter gestalten die Weide<br />
fruktanärmer<br />
05-06/<strong>2013</strong> <strong>Haflinger</strong> <strong>aktuell</strong> 11