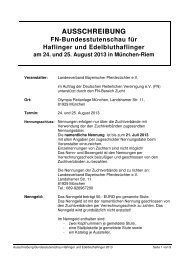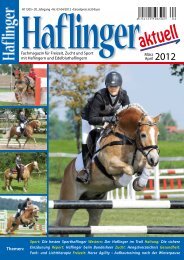Mai/Juni 2013 - Haflinger aktuell
Mai/Juni 2013 - Haflinger aktuell
Mai/Juni 2013 - Haflinger aktuell
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Erstes einen großen Hafen Milchkaffee.<br />
Man kennt sich, schätzt sich, redet über die<br />
letzten Ausfahrten oder den traditionellen<br />
Stefanieritt. Dann geht’s an die Arbeit.<br />
Die Hufeisen werden abgenommen, die<br />
Hufsohle gereinigt, der Hufstrahl (das ist<br />
der weiche Teil der Sohle, der den Huf mit<br />
Nährstoffen versorgt) mit einem messerähnlichen<br />
Gerät zugeschnitten; als Nächstes<br />
ist die Sohle dran; während Schelle den Huf<br />
hochhält, kürzt Martin ihn um 10-15 Millimeter<br />
und glättet ihn mit einer halbmeterlangen<br />
Version einer Nagelfeile.<br />
Dann wird das Hufeisen angepasst. Mit einem<br />
kurzen Fauchen zündet der auf der<br />
Ladefläche installierte schwenkbare<br />
Schmiedeofen. Blauorange leuchtet die<br />
Flamme, die von einer roten Gasflasche<br />
gespeist wird und nahezu 1.000 Grad erreicht.<br />
Nach wenigen Minuten glühen die<br />
Eisen; den Amboss hat Martin zuvor schon<br />
aus dem Wagen gewuchtet; mit einer langen<br />
Zange packt er das rot leuchtende<br />
Metall und bringt es mit einem – erstaunlich<br />
kleinen – Hammer wieder in die passende<br />
Form – eine Einzelanfertigung, Maßarbeit<br />
sozusagen. Und weil der Winter bevorsteht,<br />
fixiert Berger noch eine Gummieinlage zwischen<br />
Horn und Eisen, was dem Pferd auf<br />
eisig-rutschigem Boden mehr Grip verleihen<br />
soll.<br />
Befestigt wird das Hufeisen mit schmiedeeisernen<br />
Hufnägeln. Sie sind leicht gebogen<br />
und laufen konisch zu. Martin muss<br />
sie in die „Zona alba“, die nur 3-5 Millimeter<br />
breite weiße Linie zwischen Hufwand<br />
und Sohle, treiben; würde der Nagel in die<br />
Lederhaut eindringen und sie verletzen,<br />
kann dies zur Erlahmung des Beines führen,<br />
was unweigerlich den Tod des Pferdes bedeuten<br />
würde. Ja, Schelle und Berger haben<br />
durchaus recht, es ist eine Kunst.<br />
„Ohne Hufeisen würde ein Pferd sehr schnell<br />
seinen gesamten Gehapparat ruinieren“,<br />
belehrt Hufeisendoktor Berger zwischen<br />
zwei Hammerschlägen. Weil die Natur die<br />
Vierbeiner nicht für Straßen und gepflasterte<br />
Wege geplant hat, ist der Schutz der<br />
„vier zusätzlichen Herzen des Pferdes“, diesem<br />
keineswegs starren, sondern flexiblen<br />
Hornpolster, von größter Wichtigkeit. Und<br />
wenn man wie Magnus Schelle<br />
an die dreieinhalbtausend Kilometer<br />
pro Jahr im Zweispänner<br />
durchs Hachinger Tal kutschiert,<br />
schleifen sich die Eisen schnell<br />
ab und verlieren ihre Form.<br />
Zehenbrüche durch Pferdetritte<br />
und Verbrennungen am Schmiedeofen<br />
sind für ihn normal, sagt<br />
Berger, „das gehört zum Beruf.“<br />
Die satte Rippenprellung und die<br />
beiden Nasenbeinbrüche durch<br />
ausschlagende Pferde „muss<br />
man aushalten.“ Und da die<br />
Arbeit fast ausschließlich im Freien<br />
durchgeführt werden kann,<br />
werkelt unser Hufschmied im<br />
Winter auch bei Temperaturen<br />
von weniger als 10 Grad unter<br />
Null, feilt, hämmert und schmiedet.<br />
Keine Arbeit für „Loamsieder<br />
und Stubenhocker“.<br />
Seit 12 Jahren geht der 45-Jährige<br />
einem der ältesten Berufe<br />
der Welt nach und hat in dieser<br />
Zeit an die 10.000 Hufeisen an<br />
Pferdefüße geschlagen. Weil er<br />
seine Arbeit gut macht, wird er<br />
weiterempfohlen und „kann von<br />
dem, was ich schon immer machen wollte,<br />
leben“. Er, seine Frau Helma und die zwei<br />
Söhne Quirin (14) und Marinus (15). Wenn<br />
die Schlierseer Gebirgsschützen ihren Jahrtag<br />
begehen, die traditionelle Leonhardi-<br />
Fahrt ansteht oder eine andere Brauchtumsveranstaltung<br />
danach verlangt, helfen sie<br />
dem Papa, die beiden eigenen Rösser „Pardon“<br />
und „Dori“, süddeutsche Kaltblüter,<br />
zu bürsten, zu striegeln und zu schmücken.<br />
Auch beim Schmieren und Saubermachen<br />
des sogenannten Truhenwagens legen sie<br />
fleißig Hand an – der Lohn ist ein Platz auf<br />
dem Kutschbock neben dem Vater.<br />
Neben der Leidenschaft für Pferde hat Martin<br />
Berger eine zweite: die Blasmusik. Zweimal<br />
in der Woche spielt Martin im Münchner<br />
Hofbräuhaus auf, am Wochenende<br />
auf Festen und Feiern. Sein Instrument ist<br />
die Tuba. Oder, wie man zwischen Watzmann<br />
und Wendelstein sagt: das Bombardon.<br />
„Eigentlich wollte mein Vater, dass ich<br />
Zither lerne, aber schon als kleiner Bub hat<br />
mich die Blasmusik fasziniert.“ Es brauchte<br />
allerdings ein paar Zufälle und das Drängen<br />
zweier Freunde, um aus dem Wunsch<br />
Realität werden zu lassen. Heute verfügen<br />
er und seine wechselnden Kompagnons<br />
über ein vielseitiges Repertoire, das vom<br />
Bayerischen Defiliermarsch bis zu „Summertime“<br />
von George Gershwin reicht. „Ich<br />
sag’s mal so“, Martin wirkt ein bisschen unsicher,<br />
vielleicht weil er fürchtet, dass das,<br />
was er gleich sagen wird, zu aufgesetzt<br />
klingt, „beides, das Beschlagen von Pferden<br />
und das Musikmachen, hat ein bissl was mit<br />
Kunst zu tun. Du kannst beides lernen, aber<br />
ohne Gefühl und ohne Geschick wird das<br />
nie was Gescheites.“<br />
Text: Tristan Berger<br />
Fotos: Sebastian Gabriel<br />
05-06/<strong>2013</strong> <strong>Haflinger</strong> <strong>aktuell</strong> 27