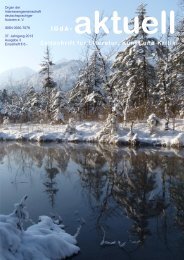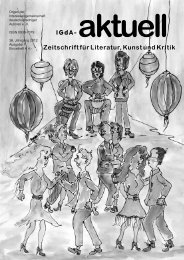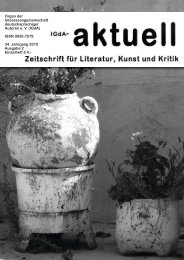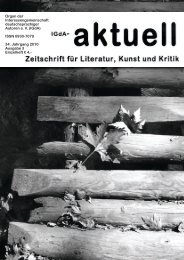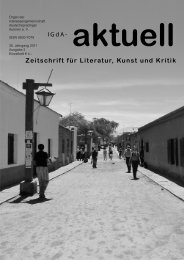Heft 4 / 2008 - Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren eV
Heft 4 / 2008 - Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren eV
Heft 4 / 2008 - Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Essay<br />
Hermann Wischnat<br />
Freie Verse lesen?<br />
Wie lesen Sie Gedichte, die in freien Versen geschrieben<br />
sind? Gemeint ist insbesondere auch<br />
das laute Lesen, also das Umsetzen des freiversigen<br />
Sprachgebildes in eine Lautgestalt.<br />
In der Lesepraxis wird dem Hörer, der den<br />
Text visuell verfolgen kann, in der Regel schnell<br />
deutlich, welche Funktion der Leser der Zeile,<br />
bzw. dem Vers zumißt. Anscheinend ist es entscheidend,<br />
ob im Lesevorgang das Zeilenende<br />
– verflüssigend oder (meist) stauend – als Zäsur<br />
berücksichtigt wird oder nicht. Wenn nicht, geht<br />
das Lesen in die vertraute syntaktisch gesteuerte<br />
Lautgestalt über, selbst wenn optische Signale<br />
eher dagegen sprechen. Das ist lesetechnisch bei<br />
„verschrobenen“ Freiversen oft gar nicht einfach.<br />
Ist demnach das Untergliedern eines Textes<br />
in freie Verse nur ein „äußeres, rein formales<br />
Merkmal“ (M. Andreotti) – also nur visuell zu<br />
orten –, und läuft das Lesen – ungeachtet der<br />
Untergliederungsvarianten – in der Satzmelodie<br />
eines Prosatextes ab, sobald das Auge die<br />
Verse sortiert und geordnet hat? Oder ergibt die<br />
graphische Gestaltung doch ein – oder gar das<br />
– „Ohrbild“ (Arno Holz) des Textes, das lesend<br />
„abzubilden“ ist?<br />
Vielleicht läßt sich die Frage an einem zunächst<br />
in Prosa abgedruckten Text veranschaulichen,<br />
den ich viermal in freie Zeilen umstelle, in freie<br />
Verse breche: „Früh legten sie ihm ein Korsett an<br />
und sagten, das sei sein Rückgrat.“<br />
1.<br />
Früh<br />
legten sie ihm<br />
ein Korsett an und sagten, das sei sein Rückgrat.<br />
2.<br />
Früh legten sie ihm<br />
Ein Korsett an und sagten,<br />
Das<br />
Sei sein Rückgrat.<br />
4.<br />
früh<br />
legten<br />
sie<br />
ihm<br />
ein<br />
korsett<br />
an<br />
und<br />
sagten<br />
das<br />
sei<br />
sein<br />
rückgrat<br />
3.<br />
Früh legten sie ihm ein<br />
Korsett<br />
an und sagten, das sei sein<br />
Rückgrat.<br />
Im Wechselverhältnis zwischen Inhalt und<br />
Form wird in diesen Beispielen durch die Änderung<br />
der Form der Inhalt je anders akzentuiert.<br />
1. In der ersten Fassung fallen die Worte „Früh“,<br />
„ihm“ und „Rückgrat“ auf. Wird „ihm“ also<br />
hier „früh“ das „Rückgrat“ gebrochen? Sind<br />
Zeilenbruch und Rückgratbruch als Assoziation<br />
vielleicht sogar übertrieben?<br />
2. In der zweiten Fassung läuft die Textgestaltung<br />
demonstrativ auf „Das“ zu. Die Großbuchstaben<br />
am Zeilenanfang betonen die<br />
Versfunktion der Zeilen. Die Verse beanspruchen<br />
demnach bei aller syntaktischen Vernetzung<br />
eine besondere Sinnfunktion. Angemerkt<br />
sei der heute häufige Einwand,<br />
Großbuchstaben am Zeilenanfang seien nur<br />
noch eine funktionslose Traditionalisme.<br />
3. Die dritte Fassung ist zentriert gestaltet. Sie<br />
signalisiert die „Mittelachse“ (Arno Holz), die<br />
zentral die Sinnworte – „sie“ / „Korsett“ / „sagten,<br />
das“ / „Rückgrat“ – trifft oder sammelt.<br />
4. Die vierte Fassung: – Macht sie ernst mit der<br />
Absicht, das einzelne Wort vom Satzzwang<br />
und vom (metrischen) Verszwang zugleich zu<br />
IGdA-aktuell, <strong>Heft</strong> 1 (2009), Seite 23