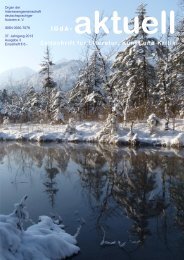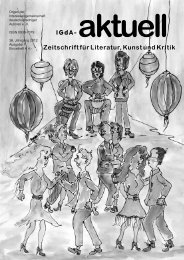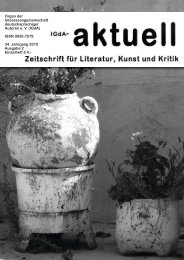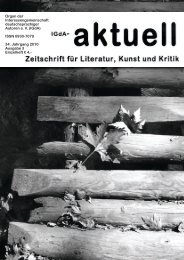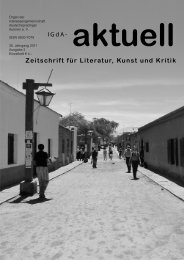Heft 4 / 2008 - Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren eV
Heft 4 / 2008 - Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren eV
Heft 4 / 2008 - Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Essay<br />
wurden – und die jedem etwas älteren von uns,<br />
und sei er nur 40 oder 50, elektronisch etwas<br />
vormachen? Können sie, die sich ihre Arbeit –<br />
das Schreiben also – ohne PC nicht mehr vorstellen<br />
können und ihre Texte gleich „eingeben“<br />
– können sie noch wirklich kreativ, schöpferisch<br />
im Sinne des Wortes sein? Oder verhindert das<br />
neue, elektronische Zeitalter des Computers<br />
subtil und indirekt das Schöpferische?<br />
Für alles gibt es da Programme: Für Wort-<br />
Trennungen, Rechtschreibung (je nach dem<br />
„alte“ oder „neue“); es gibt leicht aufzurufende<br />
Lexika, die dem Schreibenden seine Arbeit<br />
erleichtern sollen (so kann er, um Doppelnennungen<br />
zu vermeiden, ein Synonymie-Lexikon<br />
befragen). Da werden zum Beispiel Sätze, Absätze,<br />
ja ganze Abschnitte zertrennt und wieder zusammengefügt,<br />
es wird eingefügt, und alles geht<br />
per Mausklick schnell und sauber. Kurzum, der<br />
moderne Schriftsteller kann sich in mancherlei<br />
Hinsicht auf seinen elektronischen Helfer verlassen.<br />
Doch nicht selten leidet der Text darunter,<br />
und man kann mitunter bei einem schlechten<br />
(etwa bei dem eines Kollegen, für den „Zeit<br />
Geld ist“) erkennen, wo zwei Absätze oder Sätze<br />
unstimmig aneinander gefügt wurden, wo eine<br />
Kürzung den Zusammenhang oder zumindest<br />
den Fluß des Textes stört usw. Ich selbst kenne<br />
solche Texte.<br />
Birgt also nicht grade die Technisierung und<br />
Mechanisierung des Schreibens die Gefahr, vieles<br />
von dem, was einst – und noch unlängst – zum<br />
Geschäft des Schriftstellers gehörte, zu delegieren,<br />
das heißt aus der Hand zu geben, nicht mehr zu<br />
kontrollieren und irgendwann gar zu verlernen?<br />
Je mehr wir uns auf unsere elektronischen Helfer<br />
verlassen, umso mehr geben wir das Ruder des<br />
Schreibens aus der Hand. Verleitet die Arbeit mit<br />
dem Computer uns letztlich, Fauxpas wie die oben<br />
genannten zu übersehen. In der Wissenschaft, wo<br />
es um inhaltliche Mitteilung geht, mag das noch<br />
hingenommen werden können, in der Literatur ist<br />
es nicht nur ein Fauxpas, sondern verheerend und<br />
eine Unmöglichkeit!<br />
Nicht, daß es nicht auch unter den Jungen<br />
kreative Menschen und <strong>Autoren</strong> gäbe – keine Frage.<br />
Aber laufen wir nicht alle grundsätzlich Gefahr,<br />
im Rahmen jener gesellschaftlichen Veränderung<br />
„entkreativiert“ zu werden und damit durch<br />
eine wissenschaftlich gemeinten „Versachlichung“<br />
aller Phänomene unsere Kreativität und Originalität<br />
selbst zu untergraben? – allmählich, in einem<br />
langsamen, schleichenden, kaum merklichen Prozeß?<br />
Dichtung lebt vom Umgang mit Sprache als<br />
Mittel der Darstellung und Verdeutlichung der<br />
Phänomene. Inwieweit kann da Elektronik hilfreich<br />
sein?<br />
In der Lyrik kann zum Beispiel die Entmythologisierung<br />
oder besser: Entzauberung von Kunst<br />
gut beobachtet werden. Gemeint ist die durch<br />
Naturwissenschaften und Technik eingeleitete<br />
Versachlichung des Lebens: Es gibt nichts Wunderbares<br />
mehr, man versucht die Welt nüchtern<br />
zu sehen. Gemeint ist damit zugleich die „Entphilosophisierung“<br />
des Lebens: grundsätzliche Fragen,<br />
für die alle Naturwissenschaft – wenigstens<br />
bis heute – keine Erklärungen oder plausiblen<br />
Deutungen parat hat, werden wissenschaftlich<br />
versachlicht, gar nicht gestellt oder belächelnd gemieden.<br />
Dabei können auch unumstrittene Phänomene<br />
unter verschiedenen Aspekten betrachtet<br />
werden. Dieser Trend einer vermeintlichen Versachlichung<br />
aller Dinge des Lebens ist Fakt und<br />
seit geraumer Zeit beobachtbar.<br />
Eine solche „Entphilosophisierung“ von<br />
Grundfragen und -anliegen des Menschen geht<br />
aber einher mit der Entindividualisierung der Beteiligten.<br />
Denn Individualität – starke Individualität<br />
– wird in der Massengesellschaft zunehmend<br />
verdrängt und seltener, da sie einem reibungslosen<br />
Massenbetrieb stets im Wege steht; das liegt<br />
in der Natur der Sache. Gefragt sind zunehmend<br />
Menschen, die ohne Ecken und Kanten funktionieren<br />
– so wie es ihnen die technischen Entwicklungen<br />
und Errungenschaften suggerieren. Und<br />
die Massengesellschaft wird zunehmend zum<br />
Modell des Zusammenlebens der Menschen werden<br />
(solange diese sich nicht selbst umgebracht<br />
oder doch stark dezimiert haben), notgedrungen<br />
bedingt durch das stets übersehene, aber zunehmend<br />
virulente Problem der Überbevölkerung<br />
der Erde, das Rationaionalisierung und Rationalität<br />
fordert – und nicht Individualität oder tiefere<br />
Philosophie.<br />
Dichter sind – und waren schon immer – sensible<br />
Indikatoren für bevorstehende gesellschaftliche<br />
Veränderungen, Befindlichkeiten und Gefahren.<br />
Als solche aber sind sie zugleich Teil der in Aufbruch<br />
oder Wandel befindlichen Gesellschaft. Für<br />
die Lyrik bedeutet das konkret, daß sie auch deren<br />
Aus-der-Form-laufen sowie ihr Streben nach<br />
„Verwissenschaftlichung“ bzw. Versachlichung<br />
mitmacht. Dies aber bedeutet einen Abbau des<br />
Künstlerischen, den zunehmenden Verzicht auf<br />
IGdA-aktuell, <strong>Heft</strong> 1 (2009), Seite 25