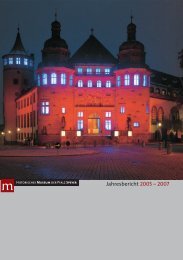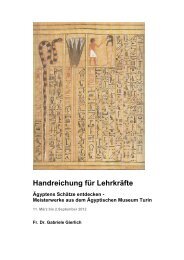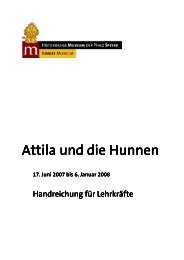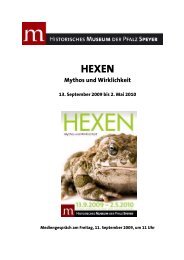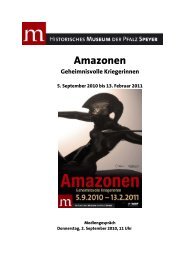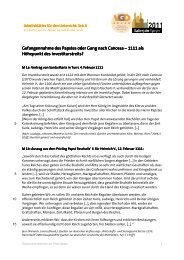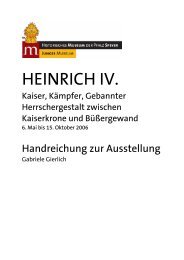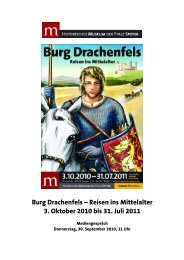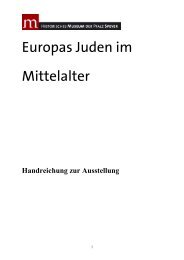Das Persische Weltreich - Historisches Museum der Pfalz Speyer
Das Persische Weltreich - Historisches Museum der Pfalz Speyer
Das Persische Weltreich - Historisches Museum der Pfalz Speyer
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
die Griechen vor allem in <strong>der</strong> Proskynese, <strong>der</strong> fußfälligen Verehrung des Königs. Die<br />
orientalische Verschwendungssucht wird nun auch in <strong>der</strong> Vasenmalerei thematisiert, indem<br />
orgiastische Umzüge mit Tänzern und Fächerträgern (übrigens ebenfalls ein Charakteristikum<br />
orientalischen Herrschergefolges) abgebildet werden. In <strong>der</strong> Ausstellung wird eine attisch<br />
rotfigurige Weinkanne mit <strong>der</strong> Darstellung eines persischen Tänzers präsentiert (Ende 5.<br />
Jh. v. Chr.), <strong>der</strong> den Oklasma-Tanz vorführt, <strong>der</strong> den Griechen als typischer Persertanz galt.<br />
Die spöttischen Darstellungen <strong>der</strong> Perser mehren sich ab <strong>der</strong> Mitte des 5. Jh. v. Chr. Ein<br />
Beispiel in <strong>der</strong> Ausstellung ist die sog. Eurymedon-Vase. Diese spielt wahrscheinlich auf<br />
einen Sieg <strong>der</strong> Griechen an <strong>der</strong> Mündung des Flusses Eurymedon in Kleinasien in den<br />
sechziger Jahren des 5. Jh. an. Auf <strong>der</strong> einen Seite <strong>der</strong> Vase ist ein Grieche zu sehen, auf <strong>der</strong><br />
gegenüberliegenden ein Perser. Der Perser steht nach vorne gebeugt, was auch durch eine<br />
Beischrift erläutert wird, die „Ich bin Eurymedon. Ich stehe vornüber gebeugt.“ lautet. Der<br />
Perser hebt ängstlich die Hände empor, Bogen und Köcher baumeln von seinem Arm herab.<br />
Der Grieche stürmt eilig heran. <strong>Das</strong> Vasenbild transportiert eine eindeutige Botschaft,<br />
nämlich dass sich <strong>der</strong> unterlegene Perser auf sexuellen Missbrauch durch den Sieger gefasst<br />
machen muss und dadurch weiter gedemütigt wird. In dieser <strong>der</strong>ben Thematik zeigt sich eine<br />
klare Gemeinsamkeit zwischen Vasenmalerei und <strong>der</strong> Alten Komödie Griechenlands.<br />
In <strong>der</strong> Komödie „Die Acharner“ des Aristophanes (ca. 445-388) tritt eine persische<br />
Gesandtschaft auf (Text im Anhang 3.5.4). Hier werden die inzwischen üblichen Klischees<br />
aktiviert: riesiger Reichtum <strong>der</strong> Perser, von denen man Unmengen von Gold als Geschenk<br />
erwartet, unmäßiger Weingenuss, Fressorgien. <strong>Das</strong>s <strong>der</strong> Perserkönig, als die Gesandtschaft<br />
bei ihm eintrifft, nicht da ist, weil er sich 8 Monate lang zum Stuhlgang in die goldenen<br />
Bergen (auch hier wie<strong>der</strong> ein Hinweis auf den persischen Reichtum) zurückgezogen hat,<br />
karikiert natürlich die körperlichen Bedürfnisse des Perserkönigs. Bei den Persern ist eben<br />
alles gigantisch vom Luxus bis zu den Körperfunktionen. Militärische Charakteristika spielen<br />
hier keine Rolle mehr und <strong>der</strong> König als Despot ist hier weniger von Bedeutung als sein<br />
unermesslicher Reichtum, <strong>der</strong> auch für die Gesandtschaft bei Aristophanes´ Acharnern eine<br />
verlockende Gefahr darstellt. Allerdings muss man einräumen, dass <strong>der</strong> Komödie nichts heilig<br />
ist und ihr Spott nicht nur die Fremden trifft, son<strong>der</strong>n auch vor den heimischen Verhältnissen<br />
nicht Halt macht.<br />
Nur in Fragmenten liegt die späteste Bearbeitung des Perserstoffes in dem Gedicht von<br />
Timotheos (ca. 450-360) vor. In den „Persern“ des Timotheos, wohl zwischen 412 und 408 v.<br />
Chr. in Athen als Gesang mit Kitharabegleitung uraufgeführt, wird die Seeschlacht von<br />
Salamis geschil<strong>der</strong>t. Dem Fragment kann man entnehmen, dass Reichtum, Luxusstreben und<br />
Verweichlichung <strong>der</strong> Perser angeprangert werden. Der Charakter <strong>der</strong> Perser wird durch<br />
Wahnsinn, Maßlosigkeit, Lautstärke, Angst, Feigheit und Unterwerfung gekennzeichnet.<br />
Obwohl nachweisbar ist, dass Timotheos die „Perser“ des Aischylos als Vorbild gedient<br />
haben, muss man die Beschreibung <strong>der</strong> Perser bei Aischylos eindeutig als ausgewogener und<br />
neutraler bezeichnen. Während bei Aischylos im Grunde <strong>der</strong> Frevel des Xerxes, den die<br />
Götter bestrafen, ursächlich für die Nie<strong>der</strong>lage ist, ist es bei Timotheos die Feigheit <strong>der</strong><br />
persischen Soldaten und die Überlegenheit <strong>der</strong> Griechen. Ziel dieses Werkes ist es nicht,<br />
Mitleid mit dem Gegner zu wecken, son<strong>der</strong>n Vorurteile gegen die Perser zu schüren und sie<br />
als abschreckendes Gegenbild hinzustellen. Als Timotheos sein Werk verfasste, wurde Athen<br />
durch den Peloponnesischen Krieg erschüttert, in dem Sparta und Athen um die Vorherrschaft<br />
in Griechenland rangen. Timotheos schien es in diesem Zusammenhang augenscheinlich<br />
angebracht, den Kampfeswillen zu stärken, indem er die persische Feigheit als negatives<br />
Beispiel vorführte. Auch Euripides Barbarenbild ist vom Eindruck des Peloponnesischen<br />
Krieges geformt. Als die reale Bedrohung durch die Perser nicht mehr existierte, werden sie<br />
zunehmend in innergriechischen Krisensituationen als Folie bemüht, um das eigene<br />
Selbstbewusstsein zu för<strong>der</strong>n und den Kampfgeist zu beschwören.<br />
42