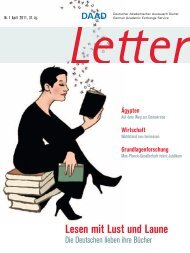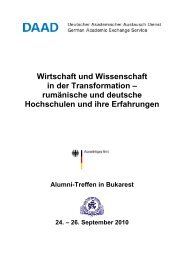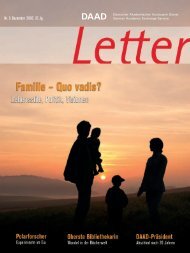Letter - DAAD-magazin
Letter - DAAD-magazin
Letter - DAAD-magazin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ihre ersten Monate in den USA verbrachte<br />
Jutta Allmendinger als Fußballtrainerin.<br />
Weil sie den Studienplatz an der University of<br />
Wisconsin in Madison nicht aufgeben wollte,<br />
die Zusage für das Stipendium aus Bonn jedoch<br />
auf sich warten ließ, hatte die couragierte<br />
26-jährige Diplom-Soziologin den Aufbruch<br />
ins ferne Studienland ganz ohne finanzielle<br />
Absicherung gewagt. Der Job, mit dem sie sich<br />
damals, im Jahr 1983, über Wasser hielt, bis<br />
das <strong>DAAD</strong>-Stipendium dann doch noch kam,<br />
lag ihr durchaus: „Ich spielte Frauenfußball<br />
und wollte ursprünglich Sportreporterin werden“,<br />
erinnert sie sich lachend.<br />
Die Episode ist typisch für die heutige Präsidentin<br />
des Wissenschaftszentrums Berlin für<br />
Sozialforschung und Professorin für Bildungssoziologie<br />
und Arbeitsmarktforschung an der<br />
Berliner Humboldt-Universität. Sie sagt von<br />
sich selbst, dass sie sich gern immer wieder<br />
auf Neues einlässt. So war das Graduiertenstudium<br />
in Madison auch nur der Beginn ihrer<br />
amerikanischen Karriere: 1984 wechselte sie<br />
nach Harvard, wo sie als Research Assistant<br />
arbeitete und 1989 promovierte.<br />
Die amerikanischen Jahre seien prägend gewesen,<br />
meint Allmendinger und erzählt von<br />
Erfahrungen, die sie in Deutschland nicht hätte<br />
machen können: Wie ihr Betreuer, Professor<br />
an der University of Madison, bei ihrer Ankunft<br />
an der Bushaltestelle stand, um sie abzuholen.<br />
Wie sie am nächsten Tag an der Universität<br />
dessen Frau begegnete und verwundert<br />
erfuhr, dass diese dort auch Professorin war<br />
– ein Beispiel für das in Deutschland bis heute<br />
selten praktizierte Dual-career-couple-Modell.<br />
Wie sie über Studierende staunte, die mit ihren<br />
Kindern in die Uni kamen.<br />
Dass sie nach Deutschland zurückkehrte,<br />
hatte nicht zuletzt mit ihrer Doktormutter in<br />
Harvard zu tun: Die ermunterte sie dazu, als<br />
<strong>DAAD</strong> <strong>Letter</strong> 2/08<br />
Gestern Stipendiatin – und heute...<br />
Jutta allmendinger<br />
Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung<br />
„Entwicklungshelferin“ die Zahl der Professorinnen<br />
in Deutschland anzuheben. Nach<br />
Stationen in Frankfurt, Mannheim und Berlin<br />
habilitierte sie an der Freien Universität Berlin<br />
und wurde 1992 als Professorin für Soziologie<br />
an die Universität München berufen, wo sie<br />
1999 einen Lehrstuhl erhielt.<br />
Als 1994 ihr Sohn Philipp zur Welt kam,<br />
passte die Professorin mit Kind am Münchner<br />
Institut nicht recht ins Bild. Schnell war ihr<br />
klar, dass sie für ihr Mitarbeiterteam ein „Vorbild“<br />
sein konnte. Kurzerhand brachte sie das<br />
Kind mit in die Uni – und sorgte für ein Mutter-Kind-Zimmer.<br />
Denn Chancengerechtigkeit<br />
für Frauen ist für Allmendinger keineswegs<br />
nur Forschungsgegenstand, sondern auch<br />
praktisches Projekt.<br />
Als sie 2003 Direktorin am Institut für Arbeitsmarkt-<br />
und Berufsforschung (IAB) in<br />
Nürnberg wurde, fand sie dort keine einzige<br />
daad<br />
Frau auf leitendem Posten. Bei ihrem Abschied<br />
Ende 2006 war der Prozentsatz von<br />
Frauen in Führungspositionen von null auf 39<br />
gestiegen. „Die Rekrutierung von Frauen in<br />
solchen ‚Männertrutzburgen’ ist schwierig“,<br />
sagt Allmendinger, „aber jede einzelne Frau<br />
war ein extremer Gewinn, und niemand am<br />
IAB stellt das in Frage.“<br />
Chancengerechtigkeit – das Thema ist für sie<br />
ein Dauerbrenner. Die Forscherin, zu deren<br />
Themen Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik,<br />
Wettbewerb, Soziale Ungleichheit und Lebensverläufe<br />
gehören, prangert vor allem die<br />
schlechten Bildungschancen für Kinder aus<br />
sozial schwachen Familien an und betont den<br />
Zusammenhang zwischen „Bildungsarmut“<br />
und „Einkommensarmut“. Sozialpolitik ist für<br />
sie auch Bildungspolitik. Deshalb hat sie am<br />
IAB, das der Nürnberger Bundesanstalt für<br />
Arbeit zuarbeitet, ein Projekt zur präventiven<br />
Bildungspolitik entwickelt. Grundlage war die<br />
wissenschaftliche Berechnung, dass es für die<br />
Gesellschaft billiger ist, in frühkindliche Erziehung<br />
zu investieren, als später Arbeitslosengeld<br />
zahlen zu müssen.<br />
Die politische Umsetzung des Projekts ist<br />
ihr wichtig, doch selbst in die Politik zu gehen,<br />
reizt sie nicht. „Der Politik fehlt der lange<br />
Atem“, sagt sie. Als Wissenschaftlerin dagegen<br />
kann sie fundierte Vorschläge erarbeiten und<br />
gut begründete Kritik üben. Das interessiert<br />
sie auch an ihrer neuen Aufgabe als Präsidentin<br />
des Wissenschaftszentrums Berlin, des<br />
größten Sozialforschungsinstituts Europas.<br />
An der renommierten gemeinnützigen Einrichtung<br />
betreiben 140 Ökonomen, Soziologen,<br />
Politologen, Juristen und Historiker „problemorientierte<br />
Grundlagenforschung“. Die<br />
leitenden Wissenschaftler lehren gleichzeitig<br />
an Berliner Universitäten. Allmendinger,<br />
die bekannt ist für ihren kommunikativen<br />
Führungsstil, arbeitet seit ihrem<br />
Amtsantritt 2007 an neuen Konzepten<br />
der Zusammenarbeit, baut „Brücken<br />
zwischen den Abteilungen“. In dem<br />
imposanten Bau am Berliner Reichpietschufer<br />
gibt es neuerdings einen<br />
Raum, der neben einem Computerarbeitsplatz<br />
auch einen Wickeltisch und<br />
Spielzeug bietet.<br />
Leonie Loreck<br />
Foto: Reiner Zensen<br />
33