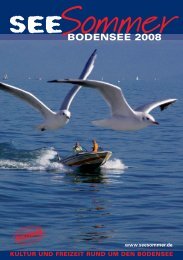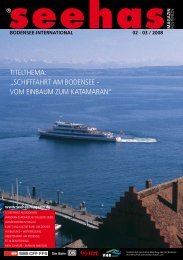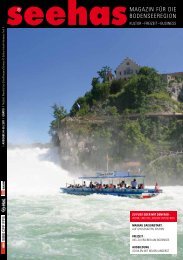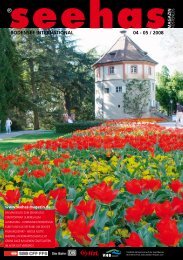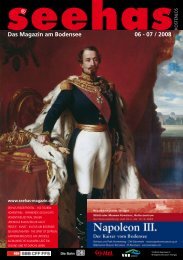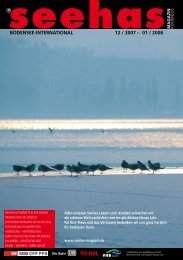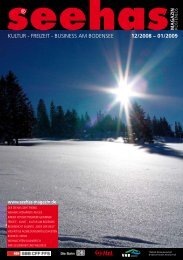freizeit - business am bodensee - Seehas Magazin
freizeit - business am bodensee - Seehas Magazin
freizeit - business am bodensee - Seehas Magazin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
INDUSTRIELEHRPFAD HAUPTWIL-BISCHOFSZELL<br />
Historische Papiermaschine und architektonisches Vermächtnis vergangener Textilindustrie<br />
Wo einst die Maschinen surrten und ausgelegte Leinwandtücher die Wiesen<br />
erstrahlen ließen, ist heute Ruhe eingekehrt. Hauptwil, ein in lieblicher Talmulde<br />
gelegenes Dörfchen liegt im Kanton Thurgau, südlich von Bischofszell,<br />
an der Grenze zum Kanton St. Gallen. Der N<strong>am</strong>e deutet darauf hin, dass der<br />
Ort ursprünglich der wichtigste Weiler in der Gegend war. Die zwei großen<br />
Geschlechter Gonzenbach und Brunnschweiler brachten zwischen dem 17.<br />
und 19. Jahrhundert die Hauptwiler Textilien zu Weltruhm.<br />
Bischofszell ist bekannt durch seine barocke Altstadt auf der Thurterrasse.<br />
Gegründet wurde Bischofszell im 9. Jahrhundert von Bischof Salomo von Konstanz.<br />
Die frühere Leinwandhochburg Bischofszell gab sich durch den industriellen<br />
Aufbruch im 19. und 20. Jahrhundert in der Papier- und Nahrungsmittelindustrie<br />
ein neues Image.<br />
Wasserkraft in Hauptwil<br />
In einer eiszeitlichen Schmelzwasserrinne ließ das St. Pelagistift aus Bischofszell<br />
1430 oberhalb von Hauptwil fünf Fischweiher anlegen. Das bescheidene<br />
Wasserangebot wurde d<strong>am</strong>it regulierbar. Am Weiherabfluss, dem späteren<br />
Dorfkanal, wurde sogleich die erste Mühle gebaut. So trieben Wasserräder seit<br />
dem 15. Jahrhundert im Sorntal und in Hauptwil Mühlen und eine Säge, die<br />
den Bauern der Umgebung dienten. Neben der Zunftfreiheit waren die günstigen<br />
Wasserverhältnisse der Hauptwiler Weihertreppe ausschlaggebend für die<br />
Standortwahl der Gebrüder Gonzenbach, die den Flecken im 17. Jahrhundert<br />
zum Handels- und Manufakturort machten.<br />
War man zunächst bei der Veredelung von Leinwand auf ausreichend Wasser,<br />
sowohl für den Bleicheprozess als auch zum Antrieb der Walken und Mangen<br />
angewiesen, so trat im 19. Jahrhundert die Rotfärberei an ihre Stelle. Im Laufe<br />
des 18. und 19. Jahrhunderts wurde das Gewässersystem stetig ausgebaut, so<br />
dass auch im Zeitalter der Industrialisierung Wasserräder bis gegen 1900 die<br />
einzigen Antriebsmotoren blieben. Erst seit auf der 1876 eröffneten Eisenbahnstrecke<br />
zwischen Sulgen und Gossau die erforderliche Steinkohle herbeigeschafft<br />
werden konnte, wurde der Einsatz von D<strong>am</strong>pfmaschinen möglich.<br />
In vorindustrieller Zeit bewegte sich ohne Wasserkraft nicht viel. Nur dank ausgeklügelten<br />
Wassernutzungssystemen entstand eine der ältesten ländlichen<br />
Manufakturen der Schweiz. Wasser blieb in der Region als Energieträger, Reinigungswasser<br />
und Stromlieferant bis in die Mitte des 20. Jh. bedeutend.<br />
Energie aus der Thur<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts förderte Bischofszell seine Industriealisierung durch<br />
Abgabe von Gratisland und die Erteilung von Wassernutzungsrechten. Der<br />
Unternehmer Johann Jakob Niederer entschloß sich, im Jahr 1856 von Hauptwil<br />
nach Bischofszell umzusiedeln, da es in Hauptwil nicht mehr möglich war,<br />
weitere Wasserkraft zu erschließen. Er verpflichtete sich, eine wassergetriebene<br />
Fabrik mit 100 Arbeitsplätzen zu errichten und erhielt als Gegenleistung von<br />
der Bürgergemeinde Bischofszell Bauholz und Boden zur Erstellung eines Wasserkanals<br />
sowie das Recht zur Wassernutzung. 1861 – 1863 entstand das 100<br />
Meter breite Wehr in der Thur bei im Unteren Ghögg und der 2 Kilometer lange,<br />
5 Meter breite und 1.8 Meter tiefe Kanal bis zur Fabrikanlage.<br />
24 SEEHAS-MAGAZIN<br />
FREIZEIT<br />
Die ganze Wasserkraftanlage umfasste das Thurwehr mit Wehrwärter-Wohnhaus,<br />
die Kiesschwemmfallen, den Oberwasserkanal, die Einlauf- und Leerlaufbauwerke,<br />
die Rechenanlagen, die Turbinen und den Unterwasserkanal.<br />
Als erstes wurde mit einer 14 PS Jonval-Turbine eine Sägerei betrieben. 1865<br />
folgte die Inbetriebnahme der Weberei mit 50 Arbeitsplätzen (100 PS Escher-<br />
Wyss-Turbine). Im 3-geschossigen Fabrikgebäude aus Nagelfluhsteinen wurden<br />
mittels Wasserkraft über Turbinen und mechanisch angeschlossener Transmissionsanlage<br />
schließlich bis 350 Jacquard-Webstühle (mit Lochkartensteuerung<br />
für die Erstellung von Mustern) angetrieben.<br />
Um die Wasserkraft besser ausnutzen zu können, wurde 1886 als Diversifizierung<br />
ein zweites Gebäude (Riegelbau) erstellt und eine ebenfalls mit Wasserturbine<br />
angetriebene Holzschleiferei und Cartonfabrik eingerichtet. Da, nicht<br />
gewinnbringend, wurde 1889 diskutiert, die Produktion einzustellen und<br />
die Wasserkraft zur Erzeugung von elektrischer Energie zur Beleuchtung von<br />
Bischofszell und St.Gallen einzusetzen. Dieses Vorhaben k<strong>am</strong> jedoch nicht zur<br />
Ausführung.<br />
1896 wurde von einer deutschen Papierfabrik eine überflüssig gewordene<br />
Papiermaschine mit einer Jahresleistung von 1000 Tonnen Papier und Halbkarton<br />
gekauft und im niedrigen Anbau vor dem Hauptgebäude installiert. Von<br />
den 350 Webstühlen wurden 150 stillgelegt. Die Wasserkraft diente nun auch<br />
zum Antrieb der so genannten Holländer für die Erzeugung des Papierstoffes.<br />
1911 wurde wegen Absatzschwierigkeiten die Weberei ganz stillgelegt. 1912<br />
entstand die Carton- und Papierfabrik G. Laager.<br />
Nach der Erhöhung des Thurwehrs im Jahr 1904 (das Gefälle bei normaler<br />
Wasserführung der Thur betrug jetzt 10 Meter) waren schließlich 5 Turbinen<br />
im Betrieb, die alle zwischen 1916 und 1936 durch Francis-Turbinen von Escher<br />
Wyss ersetzt wurden. Nach und nach wurden sie mit Generatoren ausgerüstet<br />
und d<strong>am</strong>it der mechanische Antrieb durch einen elektrischen ersetzt.<br />
Anfangs der 1980er Jahre wurden sie total überholt. Es konnten bis zu 620<br />
Kilowatt Strom erzeugt werden. Bei Wasserknappheit infolge Trockenheit oder<br />
Kälte aber auch bei Hochwasser, wenn der Rückstau der Thur den Abfluss<br />
beim Unterwasserkanal beeinträchtigte, konnte die Leistung jedoch stark<br />
abnehmen. Ursprünglich waren alle Turbinen mit Fliehkraftreglern ausgestattet<br />
und das fabrikeigene Stromnetz auf 250 Volt Drehstrom ausgerichtet. Bei der<br />
letzten Sanierung wurde auf 380 Volt umgestellt mit Frequenzimpulssteuerung<br />
aus dem öffentlichen Netz. Heute wird noch mit 4 Turbinen (eine davon als<br />
Reserve) Strom erzeugt.<br />
Die PM 1 von Bischofszell<br />
Die älteste Papiermaschine der Schweiz steht in Bischofszell. Mehr als 62 Jahre<br />
lang wurden auf ihr über 700 Papiersorten angefertigt (die unterschiedlichen<br />
Flächengewichte nicht mitgerechnet). Sie wurde im Jahre 1928 von der<br />
Maschinenfabrik Voith in Heidenheim als Nummer 353 gebaut. Bis zum Mai<br />
1991 tat sie ihren Dienst im Dreischichtbetrieb, indem sie täglich 10 bis 15<br />
Tonnen überwiegend Verpackungspapiere in Flächengewichten von 30 - 450<br />
g/qm und zuletzt vor allem „Umweltschutzpapier“ mit einer Geschwindigkeit<br />
von maximal 95 m/min und einer Breite bis 2,20 Meter erzeugte.