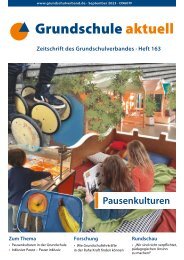GSa144_Nov2018_181022_Web_ES
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Thema: Bindung – Beziehung – Bildung<br />
Frauke Hildebrandt<br />
Ohne Bindung keine Bildung<br />
Beziehung im gemeinsamen Nachdenken<br />
Durch die Studien von John Bowlby und Mary Ainsworth zur Bindungstheorie 1<br />
wissen wir, dass Kinder durch vielfältige Interaktionen eine Bindung zu Erwachsenen<br />
aufbauen, also eine emotionale Beziehung, die über einen längeren Zeitraum<br />
anhält. Diese Bindung an ihre Bezugspersonen brauchen die Kinder, um<br />
aktiv und selbstbestimmt lernen zu können.<br />
Erwachsene sind für sie eine »sichere<br />
Basis«, von der aus sie mit<br />
anderen in Kontakt treten können<br />
und ihre Umwelt explorieren. Kinder,<br />
die sich auf keine sichere Basis verlassen<br />
können, sind vor allem anderen<br />
damit befasst, eine solche Basis für sich<br />
zu suchen; sie zeigen Bindungsverhalten.<br />
Das hindert sie daran, mit anderen<br />
Kindern in soziale Beziehungen zu treten<br />
und die Welt zu erforschen: »Man<br />
bezeichnet die Form des Zusammenspiels<br />
zwischen den Systemen des Bindungs-<br />
und Erkundungsverhaltens als<br />
komplementär gekoppelt. Das heißt,<br />
dass immer nur ein Verhaltensmuster,<br />
das Bindungsverhalten oder das Erkundungsverhalten,<br />
aktiviert sein kann. Ist<br />
das eine präsent, dann ruht das andere<br />
zu dieser Zeit. Dies führt zu der auch für<br />
Pädagogen und Pädagoginnen so wichtigen<br />
Erkenntnis, dass ein Kind ohne innere<br />
emotionale Stabilität seine Umwelt<br />
mit all den so spannenden Spielzeugen,<br />
Gegenständen und Individuen darin<br />
nicht oder nur sehr eingeschränkt entdecken<br />
kann. Oder anders formuliert:<br />
Bindung und Lernen benötigen das innere<br />
Gefühl der Sicherheit«. 2 Stabile<br />
Bindungen sind daher für kindliches<br />
Lernen nicht nur bedeutsam, sondern<br />
eine grundlegende Voraussetzung.<br />
Beziehung: Gefühle teilen<br />
Und es gibt noch einen anderen Aspekt,<br />
der Beziehung für das Lernen wichtig<br />
macht. Ein Beispiel: Oft muss ich Vorträge<br />
halten. Wie gut mir das gelingt,<br />
hängt von meiner Vorbereitung und<br />
meiner Stimmung ab, aber ganz besonders<br />
vom Publikum, also von den Menschen,<br />
die mich anhören und mir zuschauen.<br />
Neulich merkte ich das wieder<br />
deutlich, denn ich hatte zwei Vorträge<br />
kurz nacheinander zu halten. Beide<br />
Male ging es darum, wie kleine Kinder<br />
lernen und welche Lernumgebungen sie<br />
brauchen. Im ersten Fall war das Publikum<br />
zugewandt und interessiert, konstruktiv-kritisch<br />
und wohlwollend. Mein<br />
Vortrag wurde immer besser. Das merkte<br />
ich, während ich sprach.<br />
Beim nächsten Mal war die Stimmung<br />
schlecht. Ich spürte Desinteresse<br />
und Ablehnung, die Beziehung zwischen<br />
mir und der Zuhörerschaft funktionierte<br />
nicht. Lag es an meiner Person,<br />
meinen Aussagen? Das Erstaunliche:<br />
Meine Stimme klang plötzlich in meinen<br />
Ohren überhaupt nicht mehr überzeugend.<br />
Was hatte ich hier eigentlich<br />
zu suchen?<br />
Plötzlich benahm ich mich genau so,<br />
wie ich meinte, dass die Zuhörenden<br />
mich sahen, und bestätigte die Blicke,<br />
die auf mir ruhten. Tatsächlich änderten<br />
sich meine Überzeugungen und Gefühle<br />
unter diesen Blicken. Als ich das zum<br />
ersten Mal bewusst erlebt hatte, schien<br />
es mir, als habe da eine Zauberkraft gewirkt.<br />
Inzwischen kenne ich das Phänomen<br />
und bin etwas desensibilisiert und<br />
handhabe es professioneller. Jedenfalls<br />
lasse ich mich davon nicht mehr allzu<br />
sehr irritieren.<br />
Wie elementar wichtig die Sicht anderer<br />
Menschen auf uns und ihre Art, mit<br />
uns in Beziehung zu treten, für unser<br />
Selbstbild ist, bestätigen immer wieder<br />
empirische Forschungsergebnisse. Man<br />
könnte sogar sagen, dass der Blick der<br />
anderen auf uns – ihr Beziehungsangebot<br />
– dessen Ursprung ist.<br />
Ein Beispiel dafür ist die Affektspiegelung<br />
bei Babys in den ersten Lebensmonaten:<br />
Von Anfang an bilden wir als<br />
Bezugspersonen, wie Entwicklungspsychologen<br />
uns nennen, mit den Babys ein<br />
»affektives Kommunikationssystem«.<br />
Ab dem zweiten Lebensmonat beginnen<br />
sie, mit uns Gefühle – im wahrsten<br />
Sinne des Wortes – zu teilen, und wir<br />
tun das mit ihnen. Wir spiegeln ihnen<br />
positive und negative Emotionen durch<br />
unsere Mimik. Lächelt ein Baby, lächeln<br />
wir zurück, schaut ein Baby traurig oder<br />
ängstlich, blicken wir es so ähnlich an.<br />
Paradox daran ist, dass wir auch dann,<br />
wenn wir ein negatives Gefühl mimisch<br />
spiegeln, erfolgreich trösten und dem<br />
Baby helfen können, sein Gefühl zum<br />
Positiven zu regulieren. Das liegt daran,<br />
dass wir unser Spiegeln »markieren«,<br />
indem wir den Gefühlsausdruck<br />
übertreiben und dadurch seinen Alsob-Charakter<br />
verdeutlichen. Offenbar<br />
können die Babys das interpretieren. Sie<br />
können erkennen, dass wir ihre eigenen<br />
Gefühlszustände spiegeln; sie entkoppeln<br />
die ausgedrückten Gefühle von<br />
uns als Personen und schreiben sie sich<br />
selbst zu. Man könnte sagen: Erst dadurch,<br />
dass sie uns ansehen, fühlen sie,<br />
wie sie sich fühlen.<br />
Ein anderes Beispiel ist das soziale<br />
Rückversichern, das sich gegen Ende<br />
des ersten Lebensjahrs entwickelt:<br />
Babys, die sich in einer für sie unklaren<br />
Situation befinden – sie müssen<br />
ein Hindernis überwinden, um zur<br />
Bezugsperson zu kommen –, nutzen<br />
zur Entscheidungsfindung die emotionalen<br />
Gesichtsausdrücke, die wir als<br />
ihre Bezugspersonen zeigen. In ihrem<br />
Verhalten orientieren sie sich an den in<br />
unseren Gesichtern sichtbaren emotionalen<br />
Bewertungen von Situationen. Sie<br />
krabbeln los, wenn wir sie ermutigend<br />
anschauen, und halten inne, wenn wir<br />
ängstlich reagieren. Trauen wir ihnen<br />
zu, dass sie etwas schaffen, trauen sie es<br />
sich auch selbst zu.<br />
Lernen hat auch auf diese fundamentale<br />
Weise immer etwas mit Beziehung zu<br />
tun, mit Beziehungen zwischen Päda-<br />
GS aktuell 144 • November 2018<br />
9