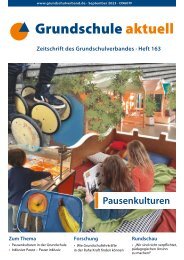GSa144_Nov2018_181022_Web_ES
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Thema: Bindung – Beziehung – Bildung<br />
sprechen, suggeriert dies, die Betroffenen<br />
seien als einzelne Individuen –<br />
losgelöst vom sozialen und politischen<br />
Kontext – ›selbst schuld‹ an ihrer Lage.<br />
An die Stelle, an der ein Diskurs um<br />
Arbeitsbedingungen und Arbeits- bzw.<br />
Lehrergesundheit geführt werden sollte,<br />
tritt sodann ein psychologischer Diskurs<br />
um individuelle Stressbewältigungsstrategien.<br />
Diese Individualisierung und<br />
Privatisierung von Problemen verdeckt<br />
paradoxerweise die Gründe für den Anstieg<br />
an Burn-out-Diagnosen, statt sie<br />
aufzudecken. Aufgrund dessen steht der<br />
Anstieg an individualistischen Psychologisierungen<br />
und Pathologisierungen<br />
in einem engen Zusammenhang zu<br />
neoliberalen Leistungsregimen.<br />
Eine zentrale These der Inklusionspädagogik<br />
ist daher, dass es stets wichtig<br />
ist, ebenjene schulischen Rahmenbedingungen<br />
und gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse<br />
im Blick zu behalten und<br />
zu fragen, wie diese die Menschen im<br />
Lernen und Arbeiten behindern (statt<br />
davon auszugehen, dass Menschen ›einfach<br />
so‹ behindert sind).<br />
In Grundschulen bedeutet dies zu<br />
fragen, ob eine zunehmende Pathologisierung<br />
von Kindern davon ablenkt,<br />
Rahmenbedingungen wie die Klassengröße,<br />
mangelnde Ressourcen, eine zu<br />
geringe Anzahl an Stunden in Doppelbesetzung<br />
(Teamteaching, zu wenig<br />
sonderpädagogische Fachkräfte, zu wenig<br />
Zeit für Kooperation etc.) zu thematisieren.<br />
Des Weiteren lenkt sie von gesamtgesellschaftlichen<br />
Problemen wie<br />
Dr. Mai-Anh Boger<br />
ist von Haus aus Sonderpädagogin und<br />
arbeitet in der AG ›Schulentwicklung<br />
und Schulforschung‹ der Universität<br />
Bielefeld. Ihre Forschungsschwerpunkte<br />
sind Theorien der Inklusion<br />
und Philosophie der Differenz.<br />
Kinderarmut, wachsender sozialer Ungleichheit<br />
und fragwürdigen Gentrifizierungsdynamiken<br />
in größeren Städten<br />
ab. Das Grundproblem der Pathologisierung<br />
besteht also darin, dass sie die<br />
zuvor genannten organisationalen und<br />
strukturellen Probleme gewissermaßen<br />
auf die Kinder abwälzt und versucht, am<br />
Individuum – also am einzelnen Kind –<br />
etwas zu ›therapieren‹, was gar nicht auf<br />
dieser Ebene entstanden ist.<br />
Da sich die guten Rahmenbedingungen<br />
für schulische Inklusion jedoch<br />
nicht so einfach herzaubern lassen und<br />
die Praxis Tag für Tag unter Handlungsdruck<br />
steht, wiederholt sich dieses<br />
Grundsatzproblem der Scheinlösung<br />
struktureller Probleme auf individueller<br />
Ebene nicht selten ohne jedwede reflexive<br />
Unterbrechung. In diesem Sinne<br />
Förderschwerpunkte in der Grundschule<br />
Abb. 2: Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Grundschule<br />
bezogen auf alle Grundschülerinnen und Grundschüler (ab 2003 ohne Niedersachsen,<br />
»da dort Aufschlüsselung nach Schularten nicht möglich« ist; KMK 2018, 12)<br />
Dr. Annette Textor<br />
ist Professorin für empirische Schulforschung<br />
an der Universität Bielefeld und<br />
wissenschaftliche Leiterin der Laborschule.<br />
Sie arbeitet schwerpunktmäßig<br />
zu den Themenbereichen Inklusion,<br />
Praxisforschung und Didaktik.<br />
ist die zunehmende Pathologisierung<br />
von Kindern ein pädagogischer Bewältigungsversuch<br />
eines nicht-pädagogischen<br />
Problems. Jedes Desaster birgt<br />
jedoch auch eine Chance.<br />
Die Chance auf eine Revitalisierung<br />
der Debatten um gute Erziehung<br />
in Grundschulen<br />
Es macht bereits einen enormen Unterschied,<br />
ob man sich der oben erläuterten<br />
Tatsache, dass es sich bei der Vermassung<br />
an Pathologisierungen um<br />
eine verzweifelte Scheinlösung handelt,<br />
bewusst ist oder nicht. Diese Tatsache<br />
nicht zu verleugnen und nicht zynisch<br />
darüber zu werden, ist der erste Schritt<br />
zur Lösung. Herrscht nämlich kein Bewusstsein<br />
darüber, dass hier strukturelle<br />
Probleme individualisiert werden,<br />
kommt es zu einem essenzialistischen<br />
Bild psychischer Störungen: Die pädagogischen<br />
Fachkräfte glauben in diesem<br />
Fall wirklich, dass dieses Kind einfach<br />
krank sei, aus sich selbst heraus defizitär<br />
in seinem Wesen, und dass dies<br />
nichts mit der Organisation von Schule<br />
und gesellschaftlichen Problemen zu tun<br />
habe. Hat man dieses Problembewusstsein<br />
jedoch erlangt, wird man den Prozess<br />
der Pathologisierung durch Einleiten<br />
eines Verfahrens zur Feststellung<br />
eines sonderpädagogischen Förderbedarfs<br />
als strategische, gar als instrumentelle<br />
Praxis verstehen. Wenn wir niemals<br />
vergessen, dass wir gerade versucht haben,<br />
ein strukturelles Problem auf individueller<br />
Ebene zu lösen, blockieren wir<br />
den Etikettierungsprozess, der dazu verführt,<br />
die so entstandene Diagnose am<br />
GS aktuell 144 • November 2018<br />
5