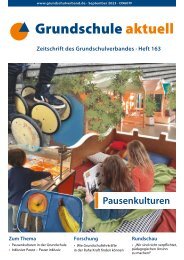GSa144_Nov2018_181022_Web_ES
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Thema: Bindung – Beziehung – Bildung<br />
rauf an, wer mehr weiß, sondern darauf,<br />
dass wir alle nachdenken können. Das<br />
können Kinder – und wie! Wenn wir ihnen<br />
Rationalität zutrauen und eine innere<br />
Welt zuschreiben, werden sie darin<br />
gestärkt, ein Bewusstsein von Individualität<br />
und Perspektivität zu entwickeln,<br />
sie erleben Wertschätzung und<br />
Relevanz ihrer eigenen Gedanken und<br />
zugleich wird im Raum der Gründe die<br />
Unterschiedlichkeit anderer bewusst.<br />
Anmerkungen<br />
1) Vgl. Bowlby, J. 1969 und Ainsworth, M.<br />
1977<br />
2) Viernickel, Völkel 2009, 13 f.<br />
3) Vgl. u. a. Dornes 2000<br />
4) Vgl. u. a. Thagard, Paul (2006): Hot<br />
Thought: Mechanisms and Applications of<br />
Emotional Cognition. Cambridge. MIT Press<br />
5) Der Philosoph Thomas Nagel hat eine<br />
Sicht, die die Perspektivität der eigenen<br />
Wahrnehmung (subjektiv und intern) der<br />
Welt (objektiv und extern) nicht mit einrechnet,<br />
einschlägig als »View from Nowhere«<br />
bezeichnet. Vgl.: Nagel, Thomas (1986): The<br />
View from Nowhere. Oxford University Press<br />
6) Vgl. Gopnik, Alison; Wellman Henry M.<br />
(2012): Reconstructing constructivism:<br />
Causal models, Bayesian learning mechanisms<br />
and the theory theory. In: Psychological<br />
Bulletin 2012 Nov; 138 (6): 1085–108<br />
7) Für Forschungen, die das Sensorium der<br />
Kinder für pädagogische Interaktionen in den<br />
Blick nehmen, vgl.<br />
Bonawitz, Elizabeth, et al. (2011): The doubleedged<br />
sword of pedagogy: Instruction limits<br />
spontaneous exploration and discovery.<br />
Cognition 120.3: 322–330<br />
Buchsbaum, D., Gopnik, A., Griffiths, T. L., &<br />
Shafto, P. (2011). Children’s imitation of causal<br />
action sequences is influenced by statistical<br />
and pedagogical evidence. Cognition, 120 (3),<br />
331–340.<br />
8) Sellars 1956; McDowell 1994<br />
9) Sylva, K. u. a. 2004<br />
10) Ein Zusammentreffen von Gehirnen<br />
11) Habermas 1981<br />
12) Habermas 1981<br />
13) Sylva, K. u. a. 2004, 154<br />
14) Hamre et al. 2013; König 2009;<br />
Siraj-Blatchford, Muttock, Sylva,<br />
Gilden & Bell 2002; Sylva et al. 2004;<br />
Sammons et al. 2004<br />
15) Carpenter et al. 1998<br />
16) Dickinson & Tabors 2001; Girolametto,<br />
Weitzmann & Greenberg 2003<br />
17) Hildebrandt, Scheidt, Hildebrandt,<br />
Hédervári-Heller & Dreier 2016<br />
18) Harris et al. 2005; Moore 1990;<br />
Lohmann und Tomasello 2003<br />
19) Hildebrandt 2016<br />
Gerlind Große<br />
Emotionsregulation<br />
und Sprache<br />
Emotionsregulation wird als Handeln definiert, mit dem ein Mensch gezielt darauf<br />
Einfluss nimmt, welche Emotionen er erlebt, wie und wann er sie erlebt und<br />
wie er sie einsetzt, um seine Ziele zu erreichen (1). Die Fähigkeit zur Emotionsregulation<br />
versetzt eine Person in die Lage, ihren Emotionen und den damit verbundenen<br />
Handlungsbereitschaften nicht mehr nur ausgeliefert zu sein, sondern<br />
aktiv Einfluss auf die Wirkung der eigenen Emotionen nehmen zu können (2).<br />
Das bedeutet auch, dass Emotionsregulation<br />
es ermöglicht,<br />
in stressvollen und emotionsgeladenen<br />
Situationen dennoch sozial<br />
angemessen, adaptiv und flexibel zu reagieren<br />
(3). Ein ganz wesentliches Ziel<br />
in der Entwicklung der Emotionsregulation<br />
für Kinder und Jugendliche besteht<br />
also darin, zu lernen, wie sie mit<br />
ihren Emotionen sozial und situativ angemessen<br />
umgehen können (4).<br />
Warum ist Emotionsregulation<br />
so wichtig für kindliche Entwicklung<br />
(und Schulerfolg)?<br />
Zu lernen, die eigenen emotionalen<br />
Erfahrungen und damit verbundene<br />
Handlungstendenzen mit persönlichen<br />
Zielen und sozialen Anforderungen in<br />
Einklang zu bringen, ist eine zentrale<br />
Entwicklungsaufgabe der frühen und<br />
mittleren Kindheit (5). Bessere Emotionsregulationsfähigkeiten<br />
stehen im<br />
Zusammenhang mit besseren sozioemotionalen<br />
Kompetenzen (6–8), mehr<br />
prosozialem Verhalten (9) sowie besseren<br />
Peer-Beziehungen (10, 11). Sie ermöglichen<br />
eine bessere Anpassung an<br />
das schulische und vorschulische Umfeld<br />
sowie bessere schulische Leistungen<br />
(12, 13). Außerdem zeigen sich Zusammenhänge<br />
zwischen dem Erleben positiver<br />
Emotionen und dem emotionalen<br />
Wohlbefinden und psychischer Gesundheit<br />
(14).<br />
Die Fähigkeit, die eigenen und die Gefühle<br />
anderer zu verstehen (Empathie),<br />
mit starken Emotionen gut umgehen zu<br />
können und soziale Hinweise wahrzunehmen,<br />
trägt maßgeblich zu positiven<br />
Peer-Beziehungen und Peer-Interaktionen<br />
bei. Kinder, die von ihren Mitschüler*innen<br />
nicht gemocht, ausgeschlossen<br />
oder gehänselt werden, haben häufiger<br />
Verhaltens- und Sozialprobleme und<br />
schlechtere schulische Leistungen als<br />
Kinder, die gemocht werden und gut sozial<br />
eingebunden sind. Solche Kinder mit<br />
hohem sozialem Gruppenstatus sind im<br />
Gegenzug oft besser darin, mit negativen<br />
Emotionen – wie Wut, Nervosität oder<br />
Traurigkeit – umgehen zu können. Sie<br />
zeigen häufiger freundliches und positives<br />
Sozialverhalten wie Kooperation und<br />
Hilfsbereitschaft (15).<br />
Emotionsregulations-Strategien<br />
Die Aneignung von Strategien, mit<br />
denen sich Emotionen in ihrer Qualität,<br />
Intensität, Dauer und Häufigkeit<br />
modifizieren lassen, stellt also eine<br />
wesentliche Entwicklungsaufgabe dar.<br />
Dabei lassen sich verschiedene Arten<br />
der Emotionsregulation unterscheiden<br />
(siehe Kasten, Larsen und Prizmic) (16).<br />
Alle Strategieformen sind sowohl intrapersonal<br />
wie interpersonal anwendbar.<br />
Allerdings sind nicht alle Strategien<br />
gleichermaßen erfolgreich. Im Vergleich<br />
der Wirksamkeit von zwei Regulationsstrategien<br />
(17) zeigte beispielsweise die<br />
Neubewertung einer negativen Situation<br />
eine höhere Funktionalität als die<br />
Unterdrückung des Gefühls. Die Neubewertung<br />
ermöglichte es, die Intensität<br />
eines negativen Gefühls tatsächlich<br />
zu reduzieren, wogegen eine Unterdrückung<br />
zwar zu einer Reduktion des Gefühlsausdrucks<br />
führte, das Gefühl selbst<br />
aber bestehen blieb. Die Unterdrückung<br />
von Gefühlen kann – im Gegensatz zur<br />
Neubewertung – sogar negative Konsequenzen<br />
auf die Gedächtnisleistung<br />
haben (18).<br />
12<br />
GS aktuell 144 • November 2018