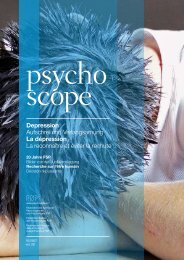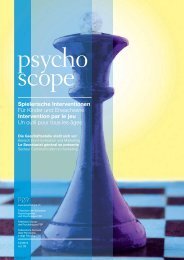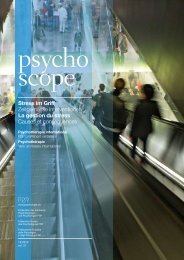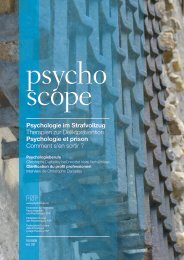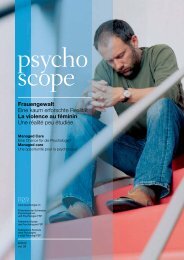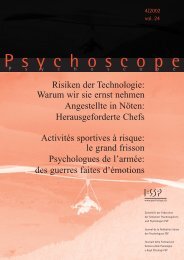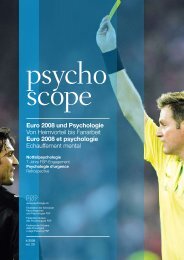15.10.2007 ET - FSP
15.10.2007 ET - FSP
15.10.2007 ET - FSP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
psychischen SF-36-Subskalen auf. Studien erwähnen<br />
in der Fachliteratur zudem oftmals psychische Probleme<br />
von Psychotherapeuten. Beide Psychotherapeutenstichproben<br />
schneiden entsprechend in allen<br />
vier SF-36-Skalen zur psychischen Gesundheit –<br />
Vitalität (VT), emotionale Rollenfunktion (ER), soziale<br />
Funktionsfähigkeit (SF) und psychisches Wohlbefinden<br />
(PW) – schlechter ab als die Altersnorm (Reimer,<br />
Jurkat, Vetter & Raskin, 2005). Dieses Ergebnis steht<br />
in Einklang mit einer Studie von Mahoney (1997), die<br />
ebenfalls auf psychische Erschöpfungszustände sowie<br />
auf Depressionsepisoden bei Psychotherapeuten hinweist.<br />
Eine Erklärung für diesen auf den ersten Blick erstaunlichen<br />
Unterschied beim Wohlbefinden gegenüber der<br />
Normalbevölkerung wäre, dass Psychotherapeuten sehr<br />
idealistische Vorstellungen von sozialen Beziehungen<br />
vertreten. Möglicherweise haben sie auch die Erwartungshaltung<br />
der Gesellschaft übernommen, dass Psychotherapeuten<br />
nahezu perfekte zwischenmenschliche<br />
Beziehungen führen sollten (Fengler, 2002), und empfinden<br />
den Vergleich mit ihrer Lebensrealität als unbefriedigend<br />
und somit stressfördernd. Andererseits beurteilen<br />
sie möglicherweise Fragen zu ihrer psychischen<br />
Gesundheit insgesamt kritischer bzw. weniger abwehrend<br />
als die Allgemeinbevölkerung (Reimer, Jurkat,<br />
Vetter & Raskin, 2005). Weitere Studien zeigen, dass<br />
auch Berufstätige in anderen akademischen Heilberufen<br />
– z.B. somatisch orientierte Humanmediziner und<br />
Zahnmediziner – Beeinträchtigungen aufzeigen: Im<br />
SF-36 weisen diese Befragten ebenfalls im Vergleich<br />
zur gleichaltrigen Allgemeinbevölkerung reduzierte<br />
Werte in den psychischen Skalen auf (Raskin, Jurkat,<br />
Vetter & Reimer, im Druck; Jurkat, Raskin, Beger &<br />
Vetter, im Druck).<br />
Die eigenen Ratschläge befolgen<br />
Zusammenfassend ergab die Studie neben den Einschränkungen<br />
bei den psychischen SF-36-Testwerten<br />
eine teilweise kritische Beurteilung des eigenen Lebensstils<br />
und generelle Gefühle der Arbeitsüberlastung.<br />
Angesichts dieser Ergebnisse scheint es für die PsychotherapeutInnen<br />
von grosser Wichtigkeit, besser auf ihr<br />
eigenes psychisches Wohlergehen zu achten; dies im<br />
Rahmen von Fort- und Weiterbildungsmassnahmen,<br />
durch Stressmanagement und nicht zuletzt, indem PsychotherapeutInnen<br />
ihre Ratschläge an die KlientInnen<br />
auch für sich selber konsequent berücksichtigen.<br />
Bibliografie<br />
Reimer, Ch., Jurkat, H.B., Vetter, A. & Raskin, K. (2005).<br />
Lebensqualität von ärztlichen und psychologischen<br />
Psychotherapeuten. Eine Vergleichsuntersuchung. Psychotherapeut,<br />
50, 107–114.<br />
Bullinger, M./Kirchberger, I. (1998). SF-36 Fragebogen<br />
zum Gesundheitszustand. Göttingen: Hogrefe.<br />
Jurkat, H.B./Reimer, Ch. (2003). Fragebogen zur Lebensqualität<br />
von Psychologinnen und Psychologen.<br />
In: H.B. Jurkat (2007). Empirische Untersuchungen zur<br />
Lebensqualität und zum Gesundheitsverhalten in Heilberufen<br />
– unter besonderer Berücksichtigung von berufstätigen<br />
Ärztinnen und Ärzten. Habilitationsschrift,<br />
Justus-Liebig-Universität Giessen.<br />
Reimer, Ch./Jurkat, H.B. (2003) Fragebogen zur Lebensqualität<br />
von Ärztinnen und Ärzten – Vollversion<br />
2003p. In: H.B. Jurkat (2007). Empirische<br />
Untersuchungen zur Lebensqualität und zum Gesundheitsverhalten<br />
in Heilberufen – unter besonderer Berücksichtigung<br />
von berufstätigen Ärztinnen und Ärzten.<br />
Habilitationsschrift, Justus-Liebig-Universität Giessen.<br />
Willutzki, U./Orlinsky, D./Cierpka, M./Ambühl, H./<br />
Laireiter, A.-R./Meverberg, J./SPR Collaborative Research<br />
Network (2006). WIR – Daten über uns. Psychotherapeuten<br />
in Deutschland, Österreich und der<br />
Schweiz. In: O. Kernberg/B. Dulz/J. Eckert (Hrsg.) WIR:<br />
Psychotherapeuten über sich und ihren «unmöglichen»<br />
Beruf (S. 26–37). Stuttgart: Schattauer Verlag.<br />
Der Autor<br />
Dr. biol. hom. Harald. B. Jurkat, Dipl.-Psych. ist seit<br />
April 1993 wissenschaftlicher Angestellter und seit<br />
2003 wissenschaftlicher Dauerbediensteter an der Klinik<br />
für Psychosomatik und Psychotherapie der Justus-<br />
Liebig-Universität Giessen.<br />
Anschrift<br />
Dr. biol. hom. Harald B. Jurkat, Dipl.-Psych.,<br />
Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie<br />
der Justus-Liebig-Universität Giessen,<br />
Friedrichstr. 33, 35392 Giessen, Deutschland<br />
E-Mail: harald.jurkat@psycho.med.uni-giessen.de<br />
Résumé<br />
Bureaucratie, difficultés financières et surtout une gestion<br />
pas toujours optimale de ses propres tensions forment<br />
une part importante de ce que les psychothérapeutes<br />
énumèrent comme facteurs de stress.<br />
L’étude menée dans l’espace germanophone par Anke<br />
Vetter, Harald Jurkat et Christian Reimer a montré que<br />
les psychothérapeutes sont dans le fond satisfaits<br />
d’une situation qui ne les empêcherait nullement d’embrasser<br />
à nouveau la même profession.<br />
Comparée à la moyenne de la population, la légère dégradation<br />
de la santé psychique des psychothérapeutes<br />
psychologues ou médicaux est expliquée par les<br />
chercheurs par une propension respectivement plus<br />
accentuée à la réflexion sur soi et à l’autocritique sur le<br />
thème même de la santé psychique.<br />
07