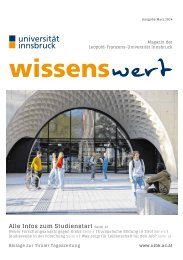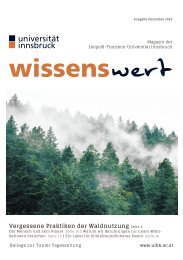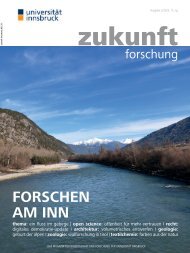Zukunft Forschung 02/2019
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ESSAY
ZUKUNFT: ZWISCHEN CHANCE
UND BEDROHUNG
Philosophin Claudia Paganini zu hoffnungsvollen Utopien
und negativen Zukunftserwartungen.
„Die Faszination der
Zukunft war und ist
so groß, dass in der
Populärkultur sogar
ein eigener Terminus
geprägt wurde:
Science-Fiction.“
CLAUDIA PAGANINI studierte
Philosophie und Theologie
an den Universitäten Innsbruck
und Wien. Nach einer
Promotion in Kulturphilosophie
2005 widmete sie sich in ihrer
Habilitationsschrift der Medienethik.
Weitere Forschungsschwerpunkte
sind Medizin-,
Tier- und Umweltethik. Derzeit
lehrt und forscht Paganini als
Vertretungsprofessorin an
der Universität Erfurt, in den
vergangenen Jahren war sie als
Gastdozentin an den Universitäten
von Mailand, Athen
und Zagreb tätig. Als erfahrene
Science-Slammerin ist es ihr
ein besonderes Anliegen, die
Inhalte der moralphilosophischen
Forschung für ein breites
Publikum verständlich und
spannend aufzubereiten.
Die Zukunft hat immer schon die
menschliche Vorstellungskraft inspiriert.
Als Spielraum des Möglichen ist
sie Gegenstand strahlender Hoffnungen ebenso
wie düsterer Befürchtungen. Literarische
Zeugnisse dieser ambivalenten Haltung gibt
es viele: Platons Atlantis um 400 v. Chr., Utopia
von Thomas Morus im 16. Jh. oder 1984 von
George Orwell im 20. Jh. Die Faszination der
Zukunft war und ist so groß, dass in der Populärkultur
sogar ein eigener Terminus geprägt
wurde: Science-Fiction. Gesichertes Wissen
und die Erfahrungen mit dem bisherigen Gang
der Geschichte werden extrapoliert, um Bilder
dessen zu entwerfen, was noch nicht existiert.
Einmal mehr finden sich hier fantastisch schillernde
Phantasien Seite an Seite mit schaurigen
Szenarien des Weltendes.
Und das ist kein Zufall. Denn auch der Abgrund
ist ein Thema, das die Einbildungskraft
des Menschen seit jeher beflügelt hat. „Ich bin
verschont geblieben, aber ich beschreibe den
Untergang“, hat der Schweizer Dramatiker
Friedrich Dürrenmatt einmal gesagt. Wie er
haben viele Künstler – Literaten, Maler, Komponisten
– das Scheitern in dunklen Farben
und bedrückenden Tönen ausgemalt. Der
tragische Held, das bloß vorgestellte Scheitern
vermögen in gewisser Weise zu beruhigen,
weil ich selbst davon nicht betroffen bin. Mitunter
aber sind wir nicht nur im Roman, auf
der Bühne oder im Film mit dem Untergang
konfrontiert. Manchmal steht man sehr konkret
vor einem Abgrund, wenn man am Berg
den Weg verfehlt hat oder wenn man sich mit
den Zahlen und Statistiken zum Klimawandel
bzw. dem Arm-Reich-Gefälle in der globalen
Gesellschaft auseinandersetzt. Zukunft, hoffnungsvolle
Utopie, antizipierter Untergang
oder reale Bedrohung?
Welche Interpretation man wählt, hängt zu
einem guten Teil vom eigenen Charakter ab,
davon, wie ich mit Unsicherheit umgehen
kann, ob es mir wichtig ist, Gewohntes beizubehalten
oder ob ich dazu tendiere, mich
begeistert in neue Abenteuer zu stürzen. Zugleich
wird die Wahrnehmung davon beeinflusst,
welche Diskurse in einer Gesellschaft
vorherrschen. Auch diese sind häufig ambivalent.
So etwa das Sprechen über Neue Medien
und Digitalisierung, wo einerseits euphorische,
den Fortschritts-Topos bedienende Szenarien
dominieren – wenn etwa eine Universität wie
die Uni Inns bruck sehr viel Geld in die Hand
nimmt, um ein Digital Science Center zu gründen
–, andererseits aber düstere Bilder – wenn
sich Bücher mit dem Titel Digitale Demenz zu
Bestsellern entwickeln und einer ganzen Generation
von Eltern tiefe Sorgenfalten auf die
Stirn treiben, sobald sie ihre Kinder beim Computerspielen
ertappen. Diese von Psychologen
wie George Milzner als „digitale Hysterie“ bezeichnete
negative Zukunftserwartung ist das
Ergebnis eines Bedrohungs-Topos, den man
regelmäßig finden kann, wenn es zu sogenannten
Medienumbrüche kommt.
Dann nämlich passen die alten Gewohnheiten
nicht mehr zu den je neuen Medien, müssen
reflektiert und verändert werden. Dies wird üblicherweise
am schmerzlichsten bewusst, wenn
die neue Technologie massenhafte Verbreitung
findet. So im alten Rom, wo der Siegeszug der
Sonnenuhr von lauten Unkenrufen begleitet
wurde. Denn für die Zeitgenossen war klar:
Mit der Sonnenuhr hatte man einen Abgott geschaffen,
der wahre Glaube war in Gefahr, der
Mensch der Tyrannei der Technik von nun an
hilflos ausgeliefert. Wenig besser ging es lange
danach dem Kabeltelefon, dem man aufgrund
der zu erwartenden Reizüberflutung und des
durch das Klingeln ausgelösten gesundheitsschädlichen
Schocks höchste Gefährlichkeit
attestierte. Beispiele wie diese gibt es viele. Sie
sollen aber nicht dazu ermuntern, aus der privilegierten
Position der später Geborenen über
die Dummheit anderer zu spotten, sondern
vielmehr aufzeigen, wie subjektiv und fehleranfällig
Zukunftsprognosen sein können. Vor
diesem Hintergrund scheint es nicht zu schaden,
die eigenen Zukunftserwartungen immer
wieder kritisch zu hinterfragen und vor allem
der Versuchung zu widerstehen, dogmatische
Positionen einzunehmen.
50 zukunft forschung 02/19
Foto: Andreas Friedle