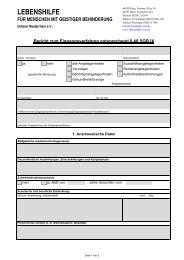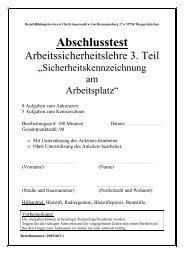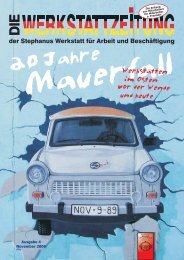1 - aktionbildung
1 - aktionbildung
1 - aktionbildung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Handbuch Berufsbildungsbereich - 14 - Vinzenz von Paul-Werkstätten, Schwäbisch Gmünd Revision 1.0, 23.09.2002 14<br />
Dabei ist es besonders wichtig, nicht den Bezug zur Lebenswirklichkeit zu verlieren. Individualität meint<br />
in diesem Sinne beispielsweise eine auf den Teilnehmer abgestimmte Unterrichts- und Ruheeinheit sowie<br />
die Verhältnismäßigkeit der beruflichen Bildungsmaßnahme.<br />
Bildungsmaßnahmen, die mit dem Verständnis von sinnvoller Tätigkeit schwer vereinbar sind (z.B. das<br />
Spiel mit Bauklötzchen) sind grundlegend abzulehnen. Formen freier Pädagogik sollen aber nicht gänzlich<br />
in den Hintergrund treten. Zwanglose Situationen bieten schwerbehinderten Menschen die Möglichkeit,<br />
sich in bestimmter Art mitzuteilen. Die Fachkraft muss die Möglichkeit haben, solche „Signale“<br />
wahrzunehmen.<br />
5.4.2 Überschaubare und nachvollziehbare Prozesse<br />
Schwerbehinderte Menschen sind in ihrer Wahrnehmung aufgrund ihrer Behinderung eingeschränkt.<br />
Ständig wechselnde Situationen oder Bezugspersonen sind für sie schwerer nachvollziehbar als für nicht<br />
behinderte Personen.<br />
Um berufliche Bildung sinnvoll zu organisieren, empfiehlt es sich, Tages- und Wochenstrukturierung<br />
möglichst gleich und nachvollziehbar zu planen. Der Teilnehmer soll die Möglichkeit erhalten, eine<br />
wiederkehrende tagesstrukturierende Ordnung zu erleben.<br />
Es macht demnach wenig Sinn, innerhalb eines Wochenplanes möglichst viele unterschiedliche Angebote<br />
einzuplanen. Denn durch die ständige Gleichmäßigkeit des Tagesablaufs, erfährt der schwerbehinderte<br />
Teilnehmer eine gewisse Sicherheit. Er erkennt feste Beziehungen zu anderen Personen. Idealerweise<br />
wird der Tagesablauf so organisiert, dass stets gleiche Bezugspersonen den Teilnehmer unterstützen.<br />
D. h. der Teilnehmer wird während seiner zweijährigen beruflichen Qualifikation von der gleichen Fachkraft<br />
unterstützt. Gleichzeitig bleibt er in seinem Gruppenverband und wechselt nicht zwischen verschiedenen<br />
Bildungsbereichen. Dadurch entsteht eine feste Ich-Du Beziehung.<br />
Der schwerstbehinderte Mensch erlebt sich als festen Teil eines Beziehungsgefüges, das nach dem universalen<br />
Prinzip der Heilpädagogik (Theunissen 1992) „eine tiefe, partnerschaftliche, kooperative und<br />
von Empathie geprägte Beziehung zwischen dem behinderten Menschen und seiner Bezugsperson“ entwickelt.<br />
5.4.3 Ganzheitlichkeit und Vorerfahrung<br />
Berufliche Bildung für Menschen mit schwersten und mehrfachen Behinderungen soll alle Sinne des<br />
Teilnehmers ansprechen (vgl. 5.1 Umgrenzung des Personenkreises, S.9). Gleichzeitig soll an die (Vor-)<br />
Erfahrungen des Teilnehmers angeknüpft werden und bereits erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten<br />
sollen stabilisiert und weiter entwickelt werden. Hierzu zählen u.a. Wahrnehmung, Sozialerfahrung,<br />
Gefühle, Körpererfahrung, Bewegung, Kognition und Kommunikation, wobei diese stets in Beziehung<br />
zueinander stehen und aufeinander einwirken.<br />
5.4.4 Angemessene Bildungsmaßnahmen<br />
Berufliche Bildung für Menschen mit schwersten Behinderungen muss sich ständig am Entwicklungsstand<br />
des Teilnehmers orientieren. Dies wird durch eine fortlaufende Förderdiagnostik, die sowohl den<br />
Entwicklungsstand als auch die subjektiven komplexen Lebenserfahrungen und -bedingungen berücksichtigt,<br />
unterstützt.<br />
Die Bildungsnahmen sollen aus einzelnen, überschaubaren Lerneinheiten bestehen. Es empfiehlt sich,<br />
die Lerneinheiten soweit wie möglich zu zergliedern (siehe auch Anlage 9.6.1 „Lernen in kleinsten<br />
Schritten“, S.67). Soweit notwendig, sollen Lerneinheiten wiederholt werden, um dem Teilnehmer eine<br />
Sicherheit im Umgang mit dem Werkstoff sowie ein Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten zu vermitteln.<br />
Produktivität im betriebswirtschaftlichen Sinn ist kein vorrangiges Ziel der beruflichen Bildung (vgl.<br />
BeB 1999, S.40). Dabei wird die Produktivität nicht generell ausgeschlossen. Die Teilnehmer des Berufsbildungsbereiches<br />
einer WfbM sollen sich primär beruflich qualifizieren und persönlich weiter entwickeln.<br />
Für Menschen mit schwersten Behinderungen gilt dies in besonderem Maße.<br />
Durch die schon oben erwähnte Gleichmäßigkeit der Prozesse, erleichtert sich weiterhin die Prognose<br />
über den Einsatz von Arbeitshilfsmitteln (z.B. spezielle Halterungen, Sägevorrichtungen etc.).<br />
14