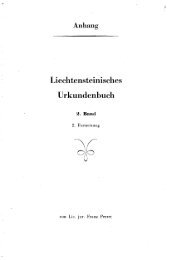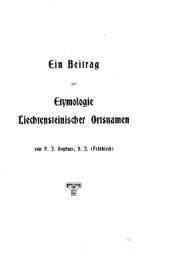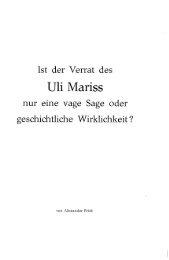und fuhrwesen im fürstentum liechtenstein - eLiechtensteinensia
und fuhrwesen im fürstentum liechtenstein - eLiechtensteinensia
und fuhrwesen im fürstentum liechtenstein - eLiechtensteinensia
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
HANDWERK UND GEWERBE<br />
Da sich bis ins 19. Jahrh<strong>und</strong>ert die agrarische<br />
<strong>liechtenstein</strong>ische Gesellschaft weitgehend selbst<br />
versorgte <strong>und</strong> sie zudem kaum über Bargeld verfügte,<br />
gab es für Handwerker <strong>und</strong> Gewerbeleute<br />
kaum Absatz- <strong>und</strong> Verdienstmöglichkeiten. Ein<br />
<strong>liechtenstein</strong>ischer Gewerbetreibender fand nicht<br />
nur <strong>im</strong> eigenen Land kaum Abnehmer für seine<br />
Produkte, es war ihm auch der Zugang zu ausländischen<br />
Märkten weitgehend versperrt. Dieser Zustand<br />
sollte sich erst durch den Abschluss des Zollvertrags<br />
mit Österreich <strong>im</strong> Jahre 1852 ändern. 246<br />
Die wenigen einhe<strong>im</strong>ischen Flandwerker wie Wagner,<br />
Sattler, Schlosser oder Schmiede waren in ihrer<br />
Produktion ganz auf die Bedürfnisse der lokalen<br />
bäuerlichen Bevölkerung eingestellt. Landvogt<br />
Schuppler beklagte 1815 ihren Dilettantismus:<br />
«Sie sind <strong>im</strong> eigentlichen Sinne nur Pfuscher,<br />
<strong>und</strong> können nicht blos wegen Mangl an Kenntnissen,<br />
sondern auch Mangl an Arbeit nicht einmal<br />
Lehrjungen aufnehmen. Die, so ihr Handwerk erlernen<br />
müssen, müssen sich bei Meistern <strong>im</strong> Auslande<br />
verdingen[,] wozu sie in der benachbarten<br />
Stadt Feldkirch die schönste Gelegenheit haben,<br />
sich nach Beendigung ihrer Lehrjahre, <strong>und</strong> erfolgter<br />
Freysprechung durch Wandern in fremden Ländern<br />
vervollkommern, auch dort, wenn sie vom<br />
Handwerk leben wollen, ihre Versorgung suchen».<br />
247<br />
Die <strong>liechtenstein</strong>ischen Nachbarschaften kannten<br />
bereits 1784 ein Hausbauverbot. 248<br />
Dieses wurde<br />
1806 durch ein oberamtliches Dekret erneuert.<br />
249<br />
Verboten war nicht nur der Neubau, sondern<br />
auch die Verdoppelung von bestehenden Häusern.<br />
Damit sollte verhindert werden, dass noch zusätzliche<br />
Leute einen Anspruch auf den Gemeindenutzen<br />
erhielten. 250<br />
Dieses Verbot verhinderte das Entstehen<br />
eines einhe<strong>im</strong>ischen Baugewerbes. Eine<br />
gewisse Monopolstellung genoss aber die bereits<br />
<strong>im</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert erwähnte Ziegelei in Nendeln,<br />
die bis zu ihrer Stillegung 1914 das gesamte Fürstentum<br />
<strong>und</strong> die nähere Umgebung mit ihren Produkten<br />
belieferte. 251<br />
DAS ROD- UND FUHRWESEN IM FÜRSTENTUM<br />
LIECHTENSTEIN / KLAUS BIEDERMANN<br />
Ebenso wenig wie die übrigen Gewerbezweige<br />
war um 1800 das Nahrungsmittelgewerbe entwickelt.<br />
Beispielsweise gab es für Bäcker kaum<br />
eine Verdienstmöglichkeit, da die meisten Haushaltungen<br />
das Brot selber buken. Verschiedene Versuche,<br />
in Liechtenstein eine Bierbrauerei zu betreiben,<br />
wurden meist nach kurzer Zeit wieder aufgegeben.<br />
1794 erhielt Anton Frommelt aus Vaduz die<br />
Erlaubnis, bei Bezahlung eines jährlichen Zinses<br />
von einem Gulden Bier zu brauen. Wegen den zu<br />
geringen Absatzmöglichkeiten (das dominierende<br />
alkoholische Getränk in Liechtenstein war der<br />
Wein!) führte er sein Vorhaben gar nicht erst<br />
aus. 252<br />
Spätere Bierbrauer, die auch in den rentamtlichen<br />
Rechnungsbüchern als Umgeldzahlende<br />
Wirtsleute auftauchten, waren: Anton Frommelt,<br />
Schaan (1811-1812), Anton Rheinberger (1821-<br />
1823) sowie ab 1842 Bierbrauer Baptist Quaderer<br />
aus Schaan. 253<br />
236) Ospelt, Wirtschaftsgeschichte. S. 182.<br />
237) Ebenda, S. 179.<br />
238) Entwicklung <strong>und</strong> Verfall des Rodwesens sind in den Kapiteln<br />
auf'S. 107 bis 135 ausführlich dargestellt.<br />
239) Bielmann. Lebensverhältnisse <strong>im</strong> Urnerland, S. 177.<br />
240) Ebenda, S. 177 f.<br />
241) Ebenda.<br />
242) Ebenda.<br />
243) Die folgenden Ausführungen stützen sich auf: Wicki, Luzern <strong>im</strong><br />
18. Jahrh<strong>und</strong>ert, S. 270 ff.<br />
244) Wicki. Luzern <strong>im</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>ert, S. 273.<br />
245) Ebenda. S. 272 u. Ospelt. Wirtschaftsgeschichte, S. 147.<br />
246) Ospelt, Wirtschaftsgeschichte, S. 227.<br />
247) 1.BS, S. 36 f.<br />
248) Vogt, Brücken zur Vergangenheit. S. 90.<br />
249) Ebenda.<br />
250) Ebenda, S. 144. Das Hausbauverbot wurde um 1840 aufgehoben.<br />
251) Ospelt, Wirtschaftsgeschichte. S. 254 f.<br />
252) Ebenda. S. 239.<br />
253) LLA Rechnungsbücher des Rentamts; vgl. Anhang auf S. 156-<br />
159. - Die Familie Quaderer betrieb das Brauereigewerbe bis zum<br />
1. Weltkrieg; erwähnt bei: Ospelt. Wirtschaftsgeschichte, S. 239 f.<br />
49