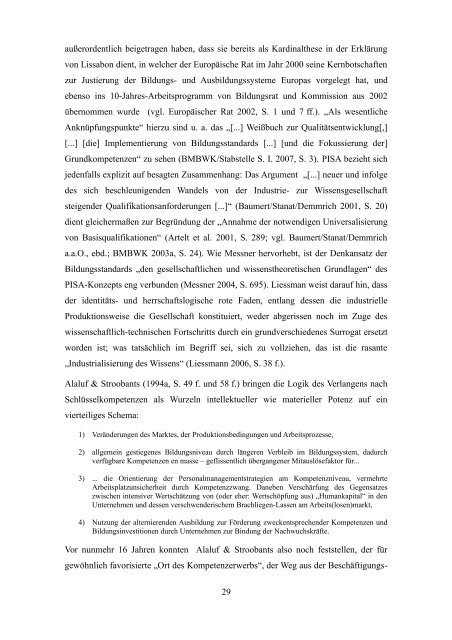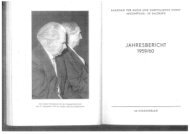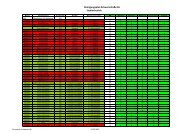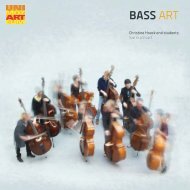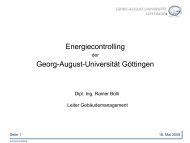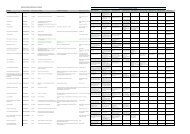- Seite 1 und 2: PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE WIEN Grenz
- Seite 3 und 4: PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE WIEN Grenz
- Seite 5 und 6: Inhaltsverzeichnis 1. Zum Aufbau de
- Seite 7 und 8: 4.2.2.6. Richtungsentscheidung ohne
- Seite 9 und 10: 1. Zum Aufbau der Arbeit Die Einlei
- Seite 11 und 12: gebung der internationalen Angleich
- Seite 13 und 14: Anliegen gewesen zu sein scheint. D
- Seite 15 und 16: Einer Zeit, in deren Bild er nicht
- Seite 17 und 18: wäre“ (Adorno 1996, S. 735, Orth
- Seite 19 und 20: erschienene einschlägige Referenzd
- Seite 21 und 22: für das Bildungswesen einen 'Refor
- Seite 23 und 24: Paradoxie, in welche sie sich damit
- Seite 25 und 26: erfordert von Anfang an Abgrenzunge
- Seite 27 und 28: Bildungs-Standard“ bereits „ein
- Seite 29: Literacy), sowie im Bereich der fä
- Seite 33 und 34: Alphabetisierung“ heutzutage nich
- Seite 35 und 36: jedoch, wie Dressler einräumt, „
- Seite 37 und 38: ereichsspezifische Leistungserwartu
- Seite 39 und 40: 2004, S. 16). 33 Es entbehrt nicht
- Seite 41 und 42: informationellen/globalen Ökonomie
- Seite 43 und 44: übergegangenen wichtigsten aller P
- Seite 45 und 46: Flechsig et al. 2007, S. 86); ein n
- Seite 47 und 48: Schülerinnen- bzw. Schülerbiograp
- Seite 49 und 50: erziehungsphilosophisch-normativer
- Seite 51 und 52: Aufnahme in das „Handbuch Kompete
- Seite 53 und 54: (Gehrer 2005, S. 2). 44 Um, wie der
- Seite 55 und 56: „Das Elend bleibt. So wie es war.
- Seite 57 und 58: Von daher wurde das „[...] Konzep
- Seite 59 und 60: eigenen Leistung, in Kombination mi
- Seite 61 und 62: anzupassen (Greving 2003, S. 122).
- Seite 63 und 64: Abb. 4: Qualitätszirkel nach Lucys
- Seite 65 und 66: näher ausgewiesenen - „[...] all
- Seite 67 und 68: Position zu entwickeln, ist wohl je
- Seite 69 und 70: In einer Situation, die sich einer
- Seite 71 und 72: leibt jedoch zu fragen, wie sich di
- Seite 73 und 74: [...]“ (Grünewald/Sowa 2006, S.
- Seite 75 und 76: dominanten visuellen Regimes die en
- Seite 77 und 78: 1999). Nach einleitenden Worten üb
- Seite 79 und 80: Schwerpunkt setzt: „Output-Orient
- Seite 81 und 82:
analog betont, sind auch für sie B
- Seite 83 und 84:
das Parlament deren Einführung bes
- Seite 85 und 86:
Bildungsstandards „Unsicherheit
- Seite 87 und 88:
3.9.3.1. Kuhn, Schumpeter und der M
- Seite 89 und 90:
S. 168 und 163) bzw. spätestens da
- Seite 91 und 92:
Ein Vexierbild wie dieses bringt un
- Seite 93 und 94:
hinwegsehen muss, weil es sie nicht
- Seite 95 und 96:
Hierin liegt vielleicht die einzig
- Seite 97 und 98:
massenhaft in die Privathaushalte E
- Seite 99 und 100:
anhaftet, ist eine falsche geworden
- Seite 101 und 102:
Personenkreis und sind immer (wenn
- Seite 103 und 104:
den Anders in der „prometheischen
- Seite 105 und 106:
außen vor lässt. Konnte selbst Ro
- Seite 107 und 108:
4. Von Kompetenzen zu Bildungsstand
- Seite 109 und 110:
Bildungsstandards und der Etablieru
- Seite 111 und 112:
„Anforderungs-“ oder „Soll-Pr
- Seite 113 und 114:
Berufswelt wird zum Vorgriff auf di
- Seite 115 und 116:
nachvollziehbare Gemeinsamkeit ab:
- Seite 117 und 118:
Zwar wird unter wortwörtlicher Ber
- Seite 119 und 120:
2010). Als impulsgebend werden imme
- Seite 121 und 122:
Wunderbare (bzw. Wundersame) daran,
- Seite 123 und 124:
Selbstentfaltung denkender Subjekte
- Seite 125 und 126:
4.2. Begriffsklärung und Kritik de
- Seite 127 und 128:
Bildungsstandards-Sympathisantinnen
- Seite 129 und 130:
Grubner/Schopf 2005, S. 10 f. bzw.
- Seite 131 und 132:
eschritten hätten und dem die gesa
- Seite 133 und 134:
Missverständnis, denn die ZK macht
- Seite 135 und 136:
jedoch auch an die von der Implemen
- Seite 137 und 138:
deren Bildungsstandards somit als f
- Seite 139 und 140:
dominiert, welche die Bildkompetenz
- Seite 141 und 142:
Bild in seinen Erscheinungsformen a
- Seite 143 und 144:
Abb. 10: Die „Zehn Ebenen der Bil
- Seite 145 und 146:
folgenden fünf „Merkmalen“: Ü
- Seite 147 und 148:
daher auch hier fünften Gesichtspu
- Seite 149 und 150:
Indem der Kompetenzbegriff so in ei
- Seite 151 und 152:
zum Synonym für Bildorientierung,
- Seite 153 und 154:
sche Institut Oberösterreich (heut
- Seite 155 und 156:
5.3. Kunst- und Lebensnähe. Leitko
- Seite 157 und 158:
Wirkungs-Zusammenhänge hinter Kuns
- Seite 159 und 160:
Schüler in ihrem persönlichen „
- Seite 161 und 162:
spitzen, entstellen, vergrößern,
- Seite 163 und 164:
5.3.3.2. Der Brandenburger Ansatz n
- Seite 165 und 166:
konzeptuelle wie auch strukturelle
- Seite 167 und 168:
gruppen bestimmter Jahrgangsstufe(n
- Seite 169 und 170:
zusammen mit den ebenfalls neuen
- Seite 171 und 172:
S. 8), die curricularen Vorgaben im
- Seite 173 und 174:
I insgesamt (vgl. dass. a.a.O., S.
- Seite 175 und 176:
den Unterrichtsskizzen des Gesamtsc
- Seite 177 und 178:
Schulformen identischen (vgl. dass.
- Seite 179 und 180:
wird als kontinuierlicher Fortschri
- Seite 181 und 182:
Tabelle 4: Ein Beispiel für inhalt
- Seite 183 und 184:
kompetenz“ sowie siebtens die Bil
- Seite 185 und 186:
das Elfenbeinturm-Klischee herauf:
- Seite 187 und 188:
und Denkweisen) und „Bildkompeten
- Seite 189 und 190:
das sich entwickelnde, handelnde Su
- Seite 191 und 192:
senes Verhalten (hinsichtlich des B
- Seite 193 und 194:
skills [...] noch immer eine Diskus
- Seite 195 und 196:
• Unterschiedliche Bildsorten und
- Seite 197 und 198:
• kann den Einfluss von Bildaufba
- Seite 199 und 200:
Bildungsstandards im Bereich der Bi
- Seite 201 und 202:
(Regel 2006, S. 346), bezeichnen. A
- Seite 203 und 204:
lassen sich die fach(bereichs)spezi
- Seite 205 und 206:
eng verbunden), „Raum und Zeit“
- Seite 207 und 208:
lichkeit, der Steigerung von Selbst
- Seite 209 und 210:
27). Fächerübergreifende Standard
- Seite 211 und 212:
6.2.1.3. Bildungsstandards Berlin u
- Seite 213 und 214:
vorhaben mit Unterstützung“, „
- Seite 215 und 216:
das Inhalt-Form-Problem (vgl. Regel
- Seite 217 und 218:
„Die Schülerinnen und Schüler
- Seite 219 und 220:
für wortgleiche Formulierungen Aus
- Seite 221 und 222:
und Notizen, schriftliche und münd
- Seite 223 und 224:
Gestalten • verschiedene Material
- Seite 225 und 226:
Erfüllung der Minimalstandards End
- Seite 227 und 228:
• Bilder verschiedener Epochen un
- Seite 229 und 230:
wiefern: verbal, durch Gebärden et
- Seite 231 und 232:
flut auf ihrer Seite wissen. Das Pr
- Seite 233 und 234:
einer mittleren Anspruchsebene im H
- Seite 235 und 236:
Manchmal wird statt „Handlungsdim
- Seite 237 und 238:
wäre dies alles im Ansatz bereits
- Seite 239 und 240:
Als Impuls für weitere Überlegung
- Seite 241 und 242:
geschaffen werden kann (vgl. Kubing
- Seite 243 und 244:
Literaturverzeichnis Abels, Heinz (
- Seite 245 und 246:
Apple, Michael W. (1992): Do the St
- Seite 247 und 248:
Belting, Hans (2005): Szenarien der
- Seite 249 und 250:
Binder, Ulrich (2009): Das Subjekt
- Seite 251 und 252:
Bormann, Inka/Gregersen, Jan (2007)
- Seite 253 und 254:
Buschor, Ernst (1997): New Public M
- Seite 255 und 256:
Derrida, Jacques (³2005): Préjug
- Seite 257 und 258:
Europäischer Rat (2002): Detaillie
- Seite 259 und 260:
Gehrer, Elisabeth (2003): Vorwort.
- Seite 261 und 262:
Grünewald, Dietrich (2008): Ziel:
- Seite 263 und 264:
Heid, Helmut (1993): Lernfähigkeit
- Seite 265 und 266:
Höbel, Wolfgang (2008): Requiem f
- Seite 267 und 268:
Kern, Augustin (2004): Vorwort. - I
- Seite 269 und 270:
KMK (Hg.) (2005c): Beschlüsse der
- Seite 271 und 272:
Lakatos, Imre (1970): Falsification
- Seite 273 und 274:
Lucyshyn, Josef/Oberndorfer, Elisab
- Seite 275 und 276:
McLuhan, Marshall (1964): Understan
- Seite 277 und 278:
Möhler, Johannes (2008): Schule de
- Seite 279 und 280:
OECD (Organisation for Economic Co-
- Seite 281 und 282:
Pfennig, Reinhard ( ⁴1970): Gegen
- Seite 283 und 284:
Rekus, Jürgen (Hg.) (2005): Bildun
- Seite 285 und 286:
Schneider, Günther/North, Brian/Ko
- Seite 287 und 288:
Skolverket (2010c): Art. (= Überse
- Seite 289 und 290:
Steiner-Khamsi, Gita (2003): Vergle
- Seite 291 und 292:
Weinert, Franz E. (2001): Vergleich
- Seite 293 und 294:
3. Bundesgesetz, mit dem das Bundes
- Seite 295:
Tabellen Tabelle 1: Hessische Bildu