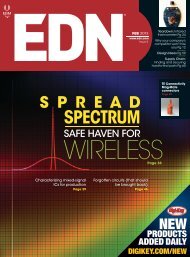4_99 c20040129 [122].pdf 7377KB Aug 21 2007
4_99 c20040129 [122].pdf 7377KB Aug 21 2007
4_99 c20040129 [122].pdf 7377KB Aug 21 2007
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
dies taten, um sich als Gegenleistung möglichst milde Strafen<br />
einzuhandeln. Aber jene, mit denen ich mich unterhielt,<br />
hatten ihre Prozesse bereits hinter sich. Viele hatten ihre<br />
Strafen schon verbüßt, und das Gespräch mit mir konnte<br />
keinem von ihnen etwas anderes einbringen als Schimpf<br />
und Schande. Stangl selbst wollte nichts weiter mehr als<br />
sprechen und dann sterben. Und Stangl ist tot. Aber wenn<br />
[…] Butz […] tatsächlich an der Wahrheit interessiert wäre,<br />
stünden ihm Stangls Frau und viele andere zur Verfügung,<br />
um Zeugnis abzulegen.«<br />
Obwohl dieser Punkt eher nebensächlich ist, will ich doch<br />
darauf verweisen, daß Sereny Stangls während der Gespräche<br />
geäußerte Hoffnungen falsch gedeutet hat. Wie sie in ihrem<br />
Buch selbst festhält, hatte er Berufung gegen seine Verurteilung<br />
zu lebenslanger Haft eingelegt; er wollte also offensichtlich<br />
aus dem Gefängnis herauskommen, ehe er starb.<br />
Jemand, der sich auch nur flüchtig mit der Treblinka-Legende<br />
befaßt hat und beispielsweise weiß, daß man zur „Vergasung“<br />
in jenem Lager angeblich die<br />
Abgase erbeuteter russischer Panzer<br />
und Lastwagen einsetzte, muß sich im<br />
klaren darüber sein, daß die Bemerkungen<br />
Serenys über ihre Gespräche mit<br />
Stangl bar jeden historischen Wertes<br />
sind. Doch auch wer solch gesunden<br />
Skeptizismus an den Tag legt, wird<br />
wohl in den meisten Fällen eine trügerische<br />
Erklärung für G. Serenys Bericht<br />
über ihre Gespräche mit Stangl liefern.<br />
Beispielsweise wird er behaupten oder<br />
andeuten, daß Sereny schlicht und einfach<br />
lügt und daß Stangl die ihm in den<br />
Mund gelegten Äußerungen niemals<br />
von sich gegeben hat. Möglicherweise<br />
wird er auch den Verdacht äußern,<br />
Stangl sei bestochen oder gefoltert<br />
worden. Daß solche Erklärungsversuche<br />
in die Irre führen, läßt sich leicht<br />
erkennen, wenn man nicht so sehr den<br />
Inhalt der Aussagen Stangls betrachtet<br />
als den historischen Hintergrund, vor<br />
dem sie erfolgt sind. Stangl war bereits<br />
ein alter Mann. Fünfundzwanzig Jahre<br />
lang hatte er immer nur dieselben<br />
Schreckensgeschichten über Treblinka<br />
gehört. Natürlich hatte er zunächst im stillen darüber gelacht.<br />
Dann gewöhnte er sich nach und nach daran, in einer Welt zu<br />
leben, in der solche Geschichten niemals öffentlich in Frage<br />
gestellt wurden. Vielleicht mag er – wie es unter solchen<br />
Verhältnissen gelegentlich geschieht – mit der Zeit selbst begonnen<br />
haben, daran zu glauben; freilich kann es auch sein,<br />
daß er in seinem Innersten weiterhin davon überzeugt war,<br />
fast alles sei nur Lug und Trug. Wir werden es wohl kaum je<br />
erfahren, doch jedenfalls war sich der unglückliche Greis bewußt,<br />
daß er bei seinen Begegnungen mit der Journalistin Sereny<br />
wirklich keinen Nutzen davon haben konnte, die<br />
Treblinka-Legende in Abrede zu stellen. Ich bin mir fast sicher,<br />
daß Gitta Sereny Stangls Aussagen mehr oder weniger<br />
korrekt wiedergegeben hat. Selbstverständlich machte er für<br />
sich selbst allerlei mildernde Umstände geltend, doch was<br />
hätte es ihm geholfen, Sereny gegenüber die Vergasungen als<br />
Mythos abzutun?<br />
Ich schrieb dem New Statesman also eine Entgegnung, die er<br />
Immer noch unübertroffen.<br />
Eine überarbeitete Neuauflage wird z.Zt.<br />
geplant von VHO, Postbus 60, B-2600<br />
Berchem 2, Belgien<br />
nicht abdruckte, die aber im Journal of Historical Review publiziert<br />
wurde: 3<br />
»Der entscheidende Punkt ist, daß solche Aussagen vermutlich<br />
eher im Hinblick auf persönliche Interessen als auf<br />
die historische Wahrheit erfolgen Bei einem Prozeß geht es<br />
um einen ganz spezifischen Tatbestand, den das Gericht zu<br />
Beginn grundsätzlich als ungeklärt betrachten sollte. Doch<br />
die These von der Judenausrottung wurde in der Praxis bei<br />
keinem der einschlägigen Prozesse je als ungeklärt betrachtet,<br />
und bei manchen war es nach der Prozeßordnung<br />
ausdrücklich untersagt, sie anzuzweifeln. Es ging stets nur<br />
um die persönliche Verantwortung der Angeklagten, niemals<br />
um die Tat als solche. Unter diesen Umständen waren<br />
die „Geständnisse“ von Deutschen, die allerdings regelmäßig<br />
ihre persönliche Schuld bestritten oder mildernde<br />
Umstände beanspruchten, die einzige unter diesen Umständen<br />
mögliche Verteidigung.<br />
Diese Taktik ist nicht ganz dasselbe wie ein Kuhhandel<br />
zwischen Anklage und Verteidigung,<br />
doch handelt es sich um einen damit<br />
verwandten Vorgang. Es ging ganz<br />
einfach darum, dem Gericht eine Geschichte<br />
zu erzählen, die es akzeptieren<br />
konnte. Dieses logische Dilemma<br />
ist unumgänglich, sobald der Angeklagte<br />
beschlossen hat, den „Prozeß“<br />
ernstzunehmen. Will er dem Gefängnis<br />
entgehen, so darf er die Legende<br />
nicht bestreiten.<br />
Sehr zu Unrecht macht die Sereny<br />
geltend, bei einer Verurteilung zu lebenslanger<br />
Haft bestehe dieses Dilemma<br />
nicht mehr. Strebt der Verurteilte<br />
nämlich eine Begnadigung oder<br />
eine Milderung des Strafmaßes an,<br />
darf er das vom Gericht als wahr<br />
Festgelegte nicht in Abrede stellen,<br />
denn damit kommt er seinem Ziel<br />
nicht näher. Beispielsweise waren<br />
dem Angeklagten Robert Mulka beim<br />
Frankfurter Auschwitz-Prozeß von<br />
1963 bis 1965 dermaßen grauenhafte<br />
Untaten zur Last gelegt worden, daß<br />
viele seine Strafe von 14 Jahren<br />
Zuchthaus als unangebracht milde<br />
rügten. Dann geschah etwas, das jeden Uneingeweihten<br />
heftig überraschten mußte: Mulka wurde ganze vier Monate<br />
später ohne viel Aufhebens auf freien Fuß gesetzt. Hätte<br />
er bei seinem Prozeß oder danach erklärt, er wisse ganz<br />
genau, daß es in Auschwitz keine Ausrottungsaktionen gab<br />
– was der Wahrheit entsprochen hätte –, so wäre er im ersten<br />
Fall zu lebenslanger Haft verurteilt worden und hätte<br />
im zweiten Fall seine 14 Jahre bis zum letzten Tag absitzen<br />
müssen, falls er überhaupt so lange gelebt hätte.<br />
Auch wenn man dies allgemein nicht weiß, gab es viele solcher<br />
Fälle; die Untersuchung des Themas ist mit großen<br />
Schwierigkeiten verbunden. 4 In keinem einzigen Fall hätte<br />
es dem Betroffenen persönlichen Nutzen gebracht, die Ausrottungsaktionen<br />
zu bestreiten. Dies war nicht der Weg, um<br />
aus dem Gefängnis herauszukommen.«<br />
Wenn man sich bei einer Debatte rein defensiv verhält und<br />
damit begnügt, die Argumente der Gegenseite zu kontern,<br />
dann halte ich dies weiterhin für die richtige Antwort auf die<br />
394 VffG · 1<strong>99</strong>9 · 3. Jahrgang · Heft 4


![4_99 c20040129 [122].pdf 7377KB Aug 21 2007](https://img.yumpu.com/10519275/36/500x640/4-99-c20040129-122pdf-7377kb-aug-21-2007.jpg)
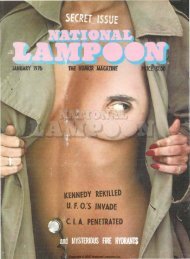

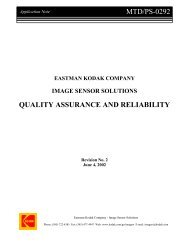
![[270].pdf 37407KB Sep 02 2010 09:55:57 AM - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/50350834/1/185x260/270pdf-37407kb-sep-02-2010-095557-am-electronicsandbooks.jpg?quality=85)
![draaien, A Viruly 1935 OCR c20130324 [320]. - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/49957773/1/190x252/draaien-a-viruly-1935-ocr-c20130324-320-electronicsandbooks.jpg?quality=85)

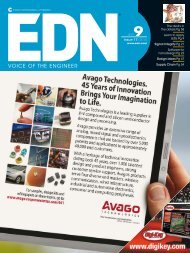

![20051110 c20051031 [105].pdf 35001KB Feb 18 2009 08:46:32 PM](https://img.yumpu.com/48687202/1/190x253/20051110-c20051031-105pdf-35001kb-feb-18-2009-084632-pm.jpg?quality=85)