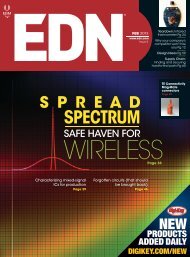4_99 c20040129 [122].pdf 7377KB Aug 21 2007
4_99 c20040129 [122].pdf 7377KB Aug 21 2007
4_99 c20040129 [122].pdf 7377KB Aug 21 2007
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
eklagte die Schenkung in seinem Inferno (19. Gesang, Verse<br />
115-117):<br />
Ahi, Constantin, di quanto mal fu matre<br />
non la tua conversion, ma quella dote<br />
che da te prese il primo ricco patre!<br />
Ach Konstantin, welches große Übel hatte zur Mutter<br />
Nicht deine Bekehrung, sondern jene Schenkung<br />
Die der erste reiche Vater von dir erhielt!<br />
So wurde diese Fälschung bei den Kontroversen über die<br />
Macht des Kaisers und des Papstes jahrhundertelang kaum je<br />
in Frage gestellt, obgleich sie so plump und anachronistisch<br />
war, wie es ein Brief mit der angeblichen Unterschrift George<br />
Washingtons gewesen wäre, in dem dieser der Methodistenkirche<br />
»die Vollmacht zur Herrschaft über Washington, D.C.,<br />
sowie die ihm unterstellten Gebiete Nordamerikas« erteilt<br />
hätte!<br />
Die ersten an der Echtheit der Urkunde geäußerten Zweifel<br />
waren bezeichnenderweise eher einfältig, trafen nicht den<br />
Kern der Sache, waren tendenziös oder abschweifend. Oft<br />
wurde, wie von Dante, nicht die historische Realität der<br />
Schenkung, sondern nur deren<br />
Wünschbarkeit in Frage gestellt. In der<br />
Mitte des 12. Jahrhunderts ritt die Reformbewegung<br />
Arnold von Brescias eine<br />
Attacke gegen die ganze Legende<br />
von Sylvester und der Schenkung, und<br />
zwar mit dem Argument, Konstantin sei<br />
bereits Christ gewesen, als er Sylvester<br />
begegnete. Unter den papstfeindlichen<br />
Gibellinen Deutschlands entstand um<br />
1200 die Legende, die Engel hätten, als<br />
Konstantin die Schenkung machte, laut<br />
geklagt: »Ach, ach, an diesem Tage<br />
ward Gift in Gottes Kirche geträufelt.«<br />
Die Anhänger des Papstes hielten dem<br />
entgegen, gewiß habe man ein Weinen<br />
gehört, doch habe es vom Teufel hergerührt,<br />
der sich verkleidet habe, um die<br />
Menschen zu täuschen. Andere warfen<br />
ein, die Schenkung sei nicht gültig, weil<br />
Konstantin der Arianischen Ketzerei<br />
zugeneigt habe, oder weil sie ohne Zustimmung<br />
des Volkes erfolgt sei, oder<br />
weil Konstantin nur für sich selbst und nicht für seine Nachfolger<br />
auf die Macht verzichtet habe. Wiederum andere drehten<br />
den Spieß um und benutzten die Schenkung, um den<br />
Papst anzugreifen: sie beweise, daß dessen Vorherrschaft<br />
nicht auf Gott, sondern auf den Kaiser zurückgehe. Dieses<br />
letztgenannte Argument wurde bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts<br />
von den antipapistischen Kräften immer wieder ins Feld<br />
geführt. Um 1200 hatten zwei Schriftsteller darauf hingewiesen,<br />
daß die kaiserliche Macht in Italien auch nach der angeblichen<br />
Schenkung ununterbrochen bestanden hatte, aber ihre<br />
Auslassungen umgingen den Kern der Frage, und sie legten<br />
keine eindeutigen Schlußfolgerungen dar. So hatten diese<br />
Schriften keinen Einfluß auf den künftigen Gang der Kontroverse.<br />
Es dauerte bis zum Jahre 1433, ehe eine solid fundierte Kritik<br />
der Schenkung erschien, und zwar nicht von einem Papstgegner,<br />
sondern von jemandem, den man als liberalen Reformer<br />
innerhalb der Kirche bezeichnen könnte. Johannes von Kues,<br />
auch Cusanus genannt, Dekan von St. Florinus in Koblenz,<br />
unterbreitete zu Händen des Konzils von Basels eine Kritik<br />
der Schenkung, in der er die überwältigenden historischen<br />
Beweise gegen jegliche Machtübertragung vom Kaiser auf<br />
den Papst während der Zeit Konstantins und Sylvesters oder<br />
unmittelbar danach darlegte.<br />
Cusanus’ Schrift De concordantia catholica erwies sich nicht<br />
als besonders folgenreich, teils wegen ihres trockenen und<br />
leidenschaftslosen Tons, teils weil sie von Lorenzo Vallas<br />
1440 erschienenen Abhandlung De falso credita et ementita<br />
Constantini donatione in den Schatten gestellt wurde. Valla<br />
werden die größten Verdienste um die Entlarvung des<br />
Schwindels zugeschrieben: Zunächst konnte er sich neben<br />
seinen eigenen bemerkenswerten Talenten auch auf die Studie<br />
Cusanus’ stützen; ferner bestach seine Abhandlung durch<br />
ihre stilistischen Qualitäten und ihre Leidenschaftlichkeit,<br />
und schließlich erlebte die Druckkunst bald darauf einen ungeheuren<br />
Aufschwung, und die Anhänger der Reformation<br />
ließen die Schrift in verschiedenen Übersetzungen in hoher<br />
Auflage verbreiten.<br />
Vallas Methode bestand darin, die Schenkung von jeder möglichen<br />
Perspektive aus zu hinterfragen. Zuerst betrachtete er<br />
die Angelegenheit vom Standpunkt<br />
Konstantins, »eines Mannes, der aus<br />
Herrschsucht Krieg gegen die Nationen<br />
geführt und Freunde sowie Verwandte<br />
in einem Bruderzwist befehdet hatte, um<br />
sie ihrer Macht zu berauben« und dann<br />
angeblich »aus reiner Großzügigkeit<br />
einem anderen die Stadt Rom, seinen<br />
Heimatort, das Haupt der Welt, die Königin<br />
der Staaten, abtrat […] und sich<br />
von dort in ein bescheidenes Städtchen,<br />
Byzanz, zurückzog«. Schon nach wenigen<br />
Seiten kommt dem Leser die Geschichte<br />
von der Schenkung ganz unglaubhaft<br />
vor, doch die Abhandlung<br />
umfaßt in ihrer englischen Übersetzung<br />
um die 80 Seiten, so daß wir es mit einem<br />
klassischen Fall von „overkill“ zu<br />
tun haben. Valla stützte Cusanus’ Argument,<br />
daß die Machtübergabe überhaupt<br />
nicht stattgefunden habe, mit dem<br />
Hinweis auf die römischen Münzen jener<br />
Zeit, die im Namen von Kaisern<br />
und nicht von Päpsten herausgegeben worden waren. Er analysierte<br />
ferner die Sprache und den Wortschatz der Schenkungsurkunde<br />
und bewies, daß sie nicht dem Latein der Konstantinischen<br />
Epoche entsprach. Solche Methoden waren damals<br />
revolutionär.<br />
Valla war kein selbstloser Gelehrter. Als er die Abhandlung<br />
verfaßte, stand er als Sekretär in den Diensten Alfonsos von<br />
Aragon, der sich mit dem Papst um die Herrschaft über Neapel<br />
stritt. Er machte kein Hehl aus seiner Auffassung, daß die<br />
weltliche Macht des Papstes von Übel sei und abgeschafft<br />
gehöre. Dennoch stellt Vallas Abhandlung einen Meilenstein<br />
in der Entstehung der historischen Kritik dar, und ich meine,<br />
daß die Auseinandersetzung mit ihr für jene, die sich heute<br />
die „Entlarvung des Völkermord-Mythos“ zum Ziel gesetzt<br />
haben, von höchstem Nutzen ist.<br />
Wohl endete noch 1458 in Straßburg ein Mann auf dem<br />
Scheiterhaufen, weil er die Echtheit der Schenkung bestritten<br />
hatte, doch fand Vallas These bei den Gebildeten von Anfang<br />
an viel Beifall, obgleich sie lange Zeit nicht gedruckt wurde.<br />
Als man das Jahr 1500 schrieb, machte es den Anschein, als<br />
396 VffG · 1<strong>99</strong>9 · 3. Jahrgang · Heft 4


![4_99 c20040129 [122].pdf 7377KB Aug 21 2007](https://img.yumpu.com/10519275/38/500x640/4-99-c20040129-122pdf-7377kb-aug-21-2007.jpg)
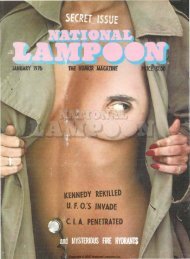

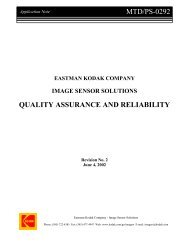
![[270].pdf 37407KB Sep 02 2010 09:55:57 AM - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/50350834/1/185x260/270pdf-37407kb-sep-02-2010-095557-am-electronicsandbooks.jpg?quality=85)
![draaien, A Viruly 1935 OCR c20130324 [320]. - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/49957773/1/190x252/draaien-a-viruly-1935-ocr-c20130324-320-electronicsandbooks.jpg?quality=85)

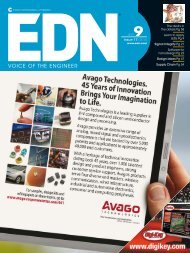

![20051110 c20051031 [105].pdf 35001KB Feb 18 2009 08:46:32 PM](https://img.yumpu.com/48687202/1/190x253/20051110-c20051031-105pdf-35001kb-feb-18-2009-084632-pm.jpg?quality=85)