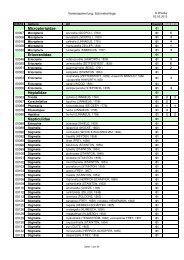Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Dahme-Heideseen ...
Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Dahme-Heideseen ...
Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Dahme-Heideseen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Märkische Ent. Nachr., Band 12, Heft 2 209<br />
b1) „Urwald“-Reliktarten n. MÜLLER et al. 2005<br />
Die Autoren unterscheiden zwei Kategorien. Kategorie 1 umfasst Reliktarten im engeren<br />
Sinne (z.B. Lacon querceus (HERBST, 1784), Limoniscus violaceus (MÜLLER,<br />
1821), Dreposcia umbrina (ERICHSON, 1837), Triplax elongata LACORDAIRE, 1842,<br />
Tenebrio opacus DUFTSCHMID, 1812, Necydalis ulmi CHEVROLAT, 1838 u.a.). Aus<br />
der Dubrow sind bisher keine Arten dieser Gruppe bekannt. Die artenreichere Kategorie<br />
2 umfasst Arten mit etwas größerer ökologischer Potenz. Zu dieser Gruppe gehören<br />
die folgenden in der Dubrow und Umgebung nachgewiesenen drei Arten:<br />
Elater ferrugineus LINNAEUS, 1758, Feuerschmied<br />
Diese auffällige aber sehr selten gefangene märkische Schnellkäferart wurde am<br />
8.7.2010 von Wolfgang Klaeber in der Dubrow beobachtet und fotografiert. Die Art<br />
entwickelt sich in Mulmhöhlen von Laubgehölzen und stellt dort, min<strong>des</strong>tens fakultativ,<br />
Rosenkäferlarven der Gattungen Protaetia und Osmoderma (Eremit) nach. - Die<br />
Art gilt in Berlin, Brandenburg und Deutschland als „stark gefährdet“.<br />
Dicerca alni FISCHER VON WALDHEIM, 1824, Erlen-Prachtkäfer<br />
Diese 2 cm große seltene Art wurde 1989, nicht weit von der Dubrow entfernt, am<br />
Pätzer Hintersee beobachtet (Foto Klaeber). Die Larven entwickeln sich in weißfaul<br />
verpilztem Stammholz von Erlen, seltener auch von Linden. - Die Art gilt für Berlin<br />
als „ausgestorben/verschollen“, für Brandenburg und Deutschland als „stark gefährdet“.<br />
Cerambyx cerdo LINNAEUS, 1758, Heldbock, Großer Eichenbock<br />
Der bis zu 54 mm große Heldbock zählt zu den größten Käfern Europas. Er entwickelt<br />
sich in sonnenexponierten physiologisch oder mechanisch geschwächten Alteichenstämmen<br />
mit einem Brusthöhendurchmesser von min<strong>des</strong>tens 60 cm und in<br />
dicken Ästen der Baumkronen. Tote Bäume werden gemieden. Die Larvalentwicklungszeit<br />
beträgt 3-5 Jahre. – Die Art ist in Berlin, Brandenburg und Deutschland<br />
„vom Aussterben“ bedroht und nach dem BNatSchG und EU-Recht streng geschützt;<br />
FFH-Art nach Anhang 2 der FFH-Richtlinie.<br />
b2) Wertgebende xylobionte Käferarten für Managementpläne n. SCHMIDL & BUßLER<br />
2004<br />
Von den 15 bisher festgestellten Arten (s. Tabelle 3) soll hier nur eine Art ausführlicher<br />
dargestellt werden, da sie zum Demonstrationsobjekt der Dubrow geworden ist:<br />
Lucanus cervus (LINNAEUS, 1758), Hirschkäfer, Feuerschröter FFH-Art<br />
Die Weibchen dieses bekanntesten europäischen Großkäfers können im Mai/Juni vor<br />
allem an Saftflüssen von Alteichen bei der Nahrungsaufnahme beobachtet werden.<br />
Die etwas früher schlüpfenden Männchen sind flugaktiver als die Weibchen und entfernen<br />
sich weiter vom Schlupfort. An „blutenden“ Eichen treffen die Männchen mit<br />
den Weibchen zusammen.<br />
Nach der Paarung sterben die Männchen bereits Ende Juni. Die Weibchen suchen,<br />
vielfach auf dem Boden laufend, noch bis Mitte Juli nach Ablageorten für ihre Eier.<br />
Diese sind verpilzte, morsche, bodenoberflächennahe Wurzelabschnitte von abgestorbenen<br />
Laubbäumen (Eiche, Kirsche, Pflaume, Birke, Weiden u.a.).