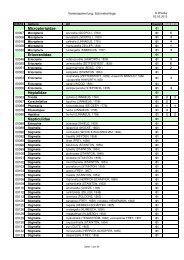Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Dahme-Heideseen ...
Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Dahme-Heideseen ...
Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Dahme-Heideseen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Märkische Ent. Nachr., Band 12, Heft 2 197<br />
1. Einleitung<br />
1874 hat Theodor Fontane mit dem Segelschiff „Sphinx“ die Gegend um Groß Köris<br />
im <strong>Dahme</strong>land bereist und im 4. Band der „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“<br />
in seinem bildhaften Stil die Ursprünglichkeit der seenreichen Landschaft mit<br />
ihren kleinen Fischerdörfern beschrieben. Ein Ausflug führte ihn auch in die Dubrow,<br />
einem bodenständigen damals noch großen Alteichenwald, der in Teilen bis 1914 als<br />
königliches und später kaiserliches Jagdrevier diente.<br />
Die von Fontane empfundene große Stille und Einsamkeit der Landschaft umfängt<br />
auch noch gegenwärtig den Wanderer, der abseits von Autobahn und Eisenbahnstrecke<br />
in der dünnbesiedelten Wald- und Seenlandschaft zu Fuß oder mit dem Fahrrad<br />
unterwegs ist und sich den Sinn dafür bewahrt hat, Stille zu genießen und Augen und<br />
Ohren den Eindrücken <strong>des</strong> Augenblicks zu öffnen.<br />
Natürlich wird er auch bemerken, dass in den 135 Jahren seit Fontanes Reise große<br />
Veränderungen in der Landschaft stattgefunden haben: Flusslaufregulierungen, Seespiegelabsenkungen<br />
mit Eutrophierungsfolgen, Komplexmeliorationsmaßnahmen,<br />
Zersiedlung von Uferstreifen, Einrichtung großflächiger Kiefernmonokulturen u.a.<br />
haben ihre Spuren hinterlassen. - Und dennoch, der stille Zauber, der über dieser<br />
Landschaft zu liegen scheint, ist geblieben. Es gibt sie noch immer, die vielen kleinen<br />
Seen und Moorsenken, im Frühjahr geschmückt mit Sumpfdotterblumen oder den<br />
flauschigen weißen Köpfchen <strong>des</strong> Wollgrases, Kranichrufe in der Ferne und mit etwas<br />
Glück sieht man auch einen Seeadler vor der dunklen Waldkulisse am See.<br />
2. Untersuchungsgebiet/Methode<br />
Vor allem die Saale- und geringerem Umfange die Weichselkaltzeit haben im <strong>Dahme</strong>gebiet<br />
große Grundmoränenflächen hinterlassen, die von Endmoränen begleitet<br />
werden. Zerschnitten werden diese Platten durch zahlreiche nacheiszeitliche Talsandgebiete<br />
und Sanderflächen. Nach Rückgang der Schmelzwässer wurden die trockenen<br />
sandigen Flussterrassen vielfach zu Dünen aufgeweht, die der Hauptwindrichtung<br />
folgten, um schließlich von Moosen, Flechten, Zwergsträuchern und Gehölzen wieder<br />
festgelegt zu werden. In der Folge entwickelten sich auf diesen Standorten in<br />
obligater Verbindung mit Mykorrhizapilzen Kiefern- und Kiefern-Traubeneichenwälder.<br />
Nach Ausschmelzen von Toteisresten im Untergrund bildeten sich kleine<br />
Seen, die sich zu Armmooren (oligotroph saure Sphagnum-Moore) entwickelten und<br />
aus deren vieltausendjährigen bis über 10m mächtigen Torfschichten von Pollenanalytikern<br />
die nacheiszeitliche Vegetationsentwicklung erschlossen werden konnte. -<br />
Das <strong>Dahme</strong>land war ursprünglich ein fast geschlossenes Waldland. Ein Mischwald<br />
aus Eichen, Kiefern, Birken mit einem geringen Anteil an Buchen, Linden und<br />
Eschen wuchs auf sandigen, stellenweise auch lehmigen und mergeligen Böden. Auf<br />
organischen Nassböden eutropher Niedermoore entwickelten sich Erlenbruchwälder.<br />
Viele der über hundert Seen <strong>des</strong> Gebietes gehören zu den nährstoffreichen Seen. Die<br />
<strong>Dahme</strong> durchfließt einige der größeren Seen <strong>des</strong> <strong>Naturparks</strong> und mündet nach relativ<br />
kurzem Lauf in Berlin-Köpenick in die Spree.