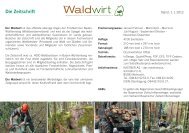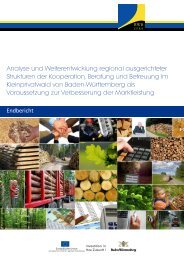4 ERGEBNISSE - Forstkammer Baden-Württemberg
4 ERGEBNISSE - Forstkammer Baden-Württemberg
4 ERGEBNISSE - Forstkammer Baden-Württemberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4 <strong>ERGEBNISSE</strong><br />
auch große Kreise mit hohen Waldanteilen das System des zentralen Kreisforstamtes mit den<br />
dezentralen Revieren umgesetzt.<br />
Eine die unteren Forstbehörden übergreifende, klare organisatorische Verankerung der Aufgabe<br />
der Privatwaldzuständigkeit ist in der Aufbauorganisation nicht zu erkennen. Die Kleinprivatwaldkompetenz<br />
wird von unterschiedlichen Organisationseinheiten und -hierarchien wahrgenommen.<br />
Das geforderte ‚come-back des Privatwaldsachbearbeiters‘ 20 spiegelt sich hier bisher nicht wider.<br />
Die Mehrheit der Revierleiter in den unteren Forstbehörden in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> ist in eigentumsgemischten<br />
Revieren tätig und favorisiert diese Struktur. In wenigen Fällen existieren Funktionalisierungen<br />
im Sinne von Dienstleistungsrevieren für die Beratung und Betreuung kommunaler<br />
und privater Waldbesitzer. Reine Privatwaldreviere, wie sie etwa in Sachsen oder Rheinland-Pfalz<br />
zu finden sind, existieren allenfalls dann, wenn sich dies durch die Gemengelage der Eigentumsstrukturen<br />
ergibt.<br />
Die generelle Bedeutung des Kleinprivatwaldes wird von den unteren Forstbehörden als hoch bis<br />
sehr hoch eingestuft. Dem stehen die Aussagen der gleichen Behörde gegenüber, dass bei einer<br />
Priorisierung der Aufgaben nach Eigentumsart und Besitzgröße der Kleinprivatwald stets nach<br />
dem Staats-, Kommunal- und größerem Privatwald eingeordnet wird.<br />
4.4 Der Kleinprivatwald und seine Organisationen<br />
Der kleinere Waldbesitz und dessen Beitrag zur Wertschöpfung stellen den Kern der Untersuchung<br />
dar; dazu fanden Datenerhebungen bei den unteren Forstbehörden und den forstwirtschaftlichen<br />
Zusammenschlüssen sowie bei einzelnen Experten statt. Bei den Waldbesitzern<br />
selbst fanden keine sozialempirischen Erhebungen statt. Aussagen zu deren Handlungsmotiven,<br />
der Bedeutung des Waldes etc. werden im Folgenden aber anhand von relevanten Forschungsergebnissen<br />
dargestellt.<br />
4.4.1 Waldbesitzer und ihre Motive<br />
Die strukturellen Merkmale des Waldbesitzes sowie die Handlungsmuster und Wertvorstellungen<br />
der Waldbesitzer und insbesondere der Kleinprivatwaldbesitzer haben sich in den letzten Jahren<br />
in starkem Maße gewandelt. <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> war und ist vom Agrarstrukturwandel betroffen.<br />
Allein in den dreißig Jahren zwischen 1971 und 2001 hat die Anzahl der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe mit Forstwirtschaft im Südschwarzwald um ein Drittel abgenommen. Dieser Rückgang<br />
der Betriebe hat sich jedoch sehr unterschiedlich in den einzelnen Besitzgrößenklassen vollzogen.<br />
So ist die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe mit Waldbesitz unter fünf Hektar im genannten<br />
Zeitraum auf die Hälfte geschrumpft, wohingegen die Anzahl der Betriebe mit Waldflächen über<br />
fünf Hektar nur um zehn Prozent zurückgegangen ist. 21 Der Agrarstrukturwandel hat somit besonders<br />
auf die Betriebe mit kleinsten Waldflächen, die im Fokus dieser Studie stehen, Auswirkungen<br />
gehabt.<br />
Der Anteil der Landwirte unter den Kleinprivatwaldbesitzern hat in den letzten Jahrzehnten stark<br />
abgenommen und ist heute relativ gering. So waren etwa bei einer Befragung von Waldbesitzern<br />
im Landkreis Tuttlingen unter 375 Waldbesitzern nur 12 Vollerwerbslandwirte. Allerdings führten<br />
61 Waldbesitzer eine Nebenerwerbslandwirtschaft. 22 Da Nicht-Landwirte in aller Regel einen anderen<br />
Bezug zum Waldbesitz haben als Landwirte und der Wald für diese Besitzergruppe nur zu<br />
einem geringeren Umfang zum Einkommen beiträgt, 23 hat die Bedeutung des Waldbesitzes, zumindest<br />
in finanzieller Hinsicht, für einen großen Teil der Waldbesitzer dieser Besitzgrößenklasse<br />
abgenommen. So haben etwa Becker und Borchers im Rahmen einer Untersuchung der Motive<br />
20 Joos, 2009, S. 61.<br />
21 Selter, 2001.<br />
22 Ebertsch, 2010.<br />
23 Siehe hierzu etwa: Becker, Borchers, 2000.<br />
WERTSCHÖPFUNG IM KLEINPRIVATWALD 47