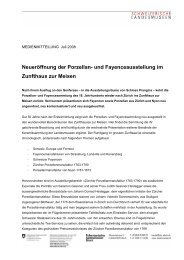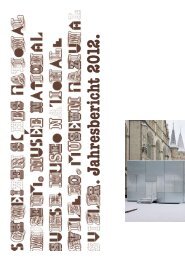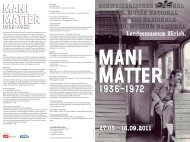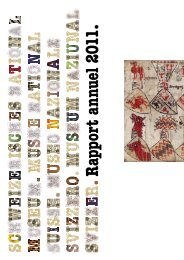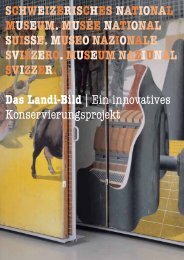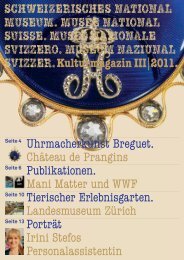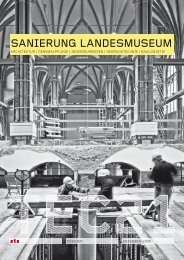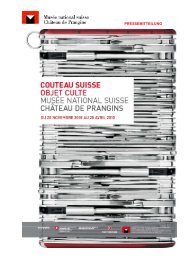Postmodernism. Style and Subversion 1970–1990» (4.9MB)
Postmodernism. Style and Subversion 1970–1990» (4.9MB)
Postmodernism. Style and Subversion 1970–1990» (4.9MB)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Miroslav Sik (1953)<br />
In Anlehnung an den Architekten Aldo Rossi entwickelte Mirsolav Sik an der ETH Zürich die<br />
Theorie der Analogen Architektur. Ziel war es, die Wirklichkeit mittels einer neuen Poetik<br />
darzustellen, indem das Vorgefundene nicht kopiert, sondern mit etwas Fremdem konfrontiert<br />
und transformiert wurde. Dabei griff er vorwiegend auf anonyme Bauten vom L<strong>and</strong>e und aus der<br />
Vorstadt zurück. Die sogenannten Analogen haben den Architekturdiskurs der damaligen Zeit<br />
wesentlich beeinflusst.<br />
Ettore Sottsass (1917–2007)<br />
Der in den späten 1960er-Jahren einflussreichste Designer Italiens verbrachte einen Grossteil<br />
seines Lebens auf Reisen. In den USA begeisterte er sich für die amerikanische Popkultur, in<br />
Indien war er von religiösen Monumenten fasziniert. Diese Eindrücke verarbeitete Sottsass in<br />
einer Reihe von Totems namens Menhir, Zikkurat, Stupas, Hydranten und Zapfsäulen. „Ich<br />
möchte mir eine Zapfsäule machen, an der ich ein Leben lang Super in meine Adern pumpen und<br />
sie dann anzünden kann“, erklärte er später.<br />
Raumbehälter für Vergnügen. Mit seiner Begeisterung für Rituale und Popkultur entfernte sich<br />
Ettore Sottsass zusehends von einer aussichtsreichen Karriere im kommerziellen Design. Ihm<br />
schwebten Gebäude vor, die als „Super-Instrumente“ für Unterhaltungszwecke fungierten und<br />
in denen man sich mit Drogen, Sex, Musik und Stars vergnügen konnte. Sottsass entwarf die<br />
Requisiten eines unkonventionellen hedonistischen Lebensstils. Der italienische Designer liess<br />
es sich nicht nehmen, mit diesen Ideen in den unterschiedlichsten Grössenordnungen zu<br />
experimentieren. Seine Gebäude ähnelten Teekannen, seine Teekannen ähnelten antiken<br />
Tempeln.<br />
Swatch<br />
Die Einführung der Swatch 1982/1983, mitten in der Krise der Uhrenindustrie, ist nicht das<br />
Ergebnis einer gr<strong>and</strong>iosen Marketing-Strategie. Vielmehr geht ihre Entwicklung auf<br />
betriebswirtschaftliche Überlegungen zurück, die Herstellungskosten durch Reduktion der<br />
Best<strong>and</strong>teile zu senken. Im Laufe der Entwicklungsarbeit kristallisierte sich die Plastikuhr als<br />
einzig gangbare Lösung heraus. Der vielfältige und schnell wechselnde Look, die Bezüge zu<br />
Mode und Grafik sowie die auf ein junges Publikum ausgerichtete Werbung machten die Swatch<br />
zu einem typischen Produkt der gestylten Achtzigerjahre.<br />
Schweizerisches Nationalmuseum. | L<strong>and</strong>esmuseum Zürich. | Bildung & Vermittlung 54