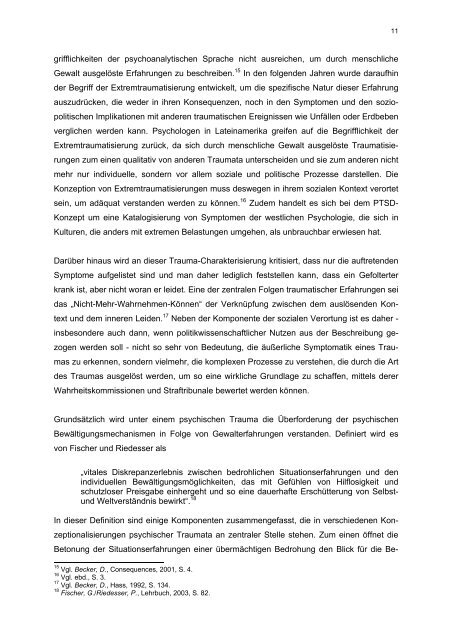"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
11<br />
grifflichkeiten der psychoanalytischen Sprache nicht ausreichen, um durch menschliche<br />
Gewalt ausgelöste Erfahrungen zu beschreiben. 15 In den folgenden Jahren wurde daraufhin<br />
der Begriff der Extremtraumatisierung entwickelt, um die spezifische Natur dieser Erfahrung<br />
auszudrücken, die weder in ihren Konsequenzen, noch in den Symptomen und den soziopolitischen<br />
Implikationen mit anderen traumatischen Ereignissen wie Unfällen oder Erdbeben<br />
verglichen werden kann. Psychologen in Lateinamerika greifen auf die Begrifflichkeit der<br />
Extremtraumatisierung zurück, da sich durch menschliche Gewalt ausgelöste Traumatisierungen<br />
zum einen qualitativ von anderen Traumata unterscheiden und sie zum anderen nicht<br />
mehr nur individuelle, sondern vor allem soziale und politische Prozesse darstellen. Die<br />
Konzeption von Extremtraumatisierungen muss deswegen in ihrem sozialen Kontext verortet<br />
sein, um adäquat verstanden werden zu können. 16 Zudem handelt es sich bei dem PTSD-<br />
Konzept um eine Katalogisierung von Symptomen der westlichen Psychologie, die sich in<br />
Kulturen, die anders mit extremen Belastungen umgehen, als unbrauchbar erwiesen hat.<br />
Darüber hinaus wird an dieser Trauma-Charakterisierung kritisiert, dass nur die auftretenden<br />
Symptome aufgelistet sind und man daher lediglich feststellen kann, dass ein Gefolterter<br />
krank ist, aber nicht woran er leidet. Eine der zentralen Folgen traumatischer Erfahrungen sei<br />
das „Nicht-Mehr-Wahrnehmen-Können“ der Verknüpfung zwischen dem auslösenden Kontext<br />
und dem inneren Leiden. 17 Neben der Komponente der sozialen Verortung ist es daher -<br />
insbesondere auch dann, wenn politikwissenschaftlicher Nutzen aus der Beschreibung gezogen<br />
werden soll - nicht so sehr von Bedeutung, die äußerliche Symptomatik eines Traumas<br />
zu erkennen, sondern vielmehr, die komplexen Prozesse zu verstehen, die durch die Art<br />
des Traumas ausgelöst werden, um so eine wirkliche Grundlage zu schaffen, mittels derer<br />
Wahrheitskommissionen und Straftribunale bewertet werden können.<br />
Grundsätzlich wird unter einem psychischen Trauma die Überforderung der psychischen<br />
Bewältigungsmechanismen in Folge von Gewalterfahrungen verstanden. Definiert wird es<br />
von Fischer und Riedesser als<br />
„vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationserfahrungen und den<br />
individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und<br />
schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbstund<br />
Weltverständnis bewirkt“. 18<br />
In dieser Definition sind einige Komponenten zusammengefasst, die in verschiedenen Konzeptionalisierungen<br />
psychischer Traumata an zentraler Stelle stehen. Zum einen öffnet die<br />
Betonung der Situationserfahrungen einer übermächtigen Bedrohung den Blick <strong>für</strong> die Be-<br />
15 Vgl. Becker, D., Consequences, 2001, S. 4.<br />
16 Vgl. ebd., S. 3.<br />
17 Vgl. Becker, D., Hass, 1992, S. 134.<br />
18 Fischer, G./Riedesser, P., Lehrbuch, 2003, S. 82.