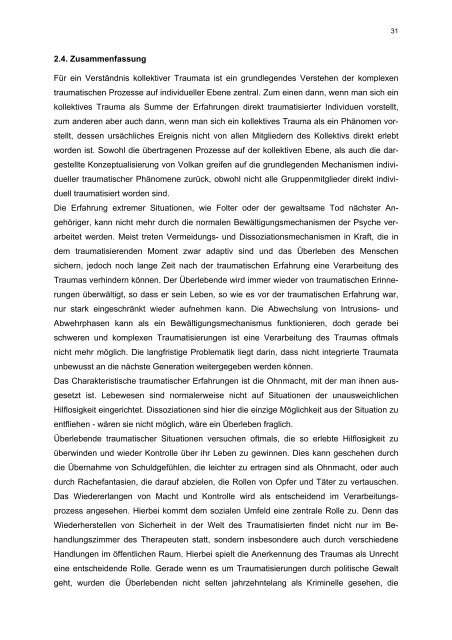"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
31<br />
2.4. Zusammenfassung<br />
Für ein Verständnis <strong>kollektiver</strong> Traumata ist ein grundlegendes Verstehen der komplexen<br />
traumatischen Prozesse auf individueller Ebene zentral. Zum einen dann, wenn man sich ein<br />
kollektives Trauma als Summe der Erfahrungen direkt traumatisierter Individuen vorstellt,<br />
zum anderen aber auch dann, wenn man sich ein kollektives Trauma als ein Phänomen vorstellt,<br />
dessen ursächliches Ereignis nicht von allen Mitgliedern des Kollektivs direkt erlebt<br />
worden ist. Sowohl die übertragenen Prozesse auf der kollektiven Ebene, als auch die dargestellte<br />
Konzeptualisierung von Volkan greifen auf die grundlegenden Mechanismen individueller<br />
traumatischer Phänomene zurück, obwohl nicht alle Gruppenmitglieder direkt individuell<br />
traumatisiert worden sind.<br />
Die Erfahrung extremer Situationen, wie Folter oder der gewaltsame Tod nächster Angehöriger,<br />
kann nicht mehr durch die normalen Bewältigungsmechanismen der Psyche verarbeitet<br />
werden. Meist treten Vermeidungs- und Dissoziationsmechanismen in Kraft, die in<br />
dem traumatisierenden Moment zwar adaptiv sind und das Überleben des Menschen<br />
sichern, jedoch noch lange Zeit nach der traumatischen Erfahrung eine Verarbeitung des<br />
Traumas verhindern können. Der Überlebende wird immer wieder von traumatischen Erinnerungen<br />
überwältigt, so dass er sein Leben, so wie es vor der traumatischen Erfahrung war,<br />
nur stark eingeschränkt wieder aufnehmen kann. Die Abwechslung von Intrusions- und<br />
Abwehrphasen kann als ein Bewältigungsmechanismus funktionieren, doch gerade bei<br />
schweren und komplexen Traumatisierungen ist eine Verarbeitung des Traumas oftmals<br />
nicht mehr möglich. Die langfristige Problematik liegt darin, dass nicht integrierte Traumata<br />
unbewusst an die nächste Generation weitergegeben werden können.<br />
Das Charakteristische traumatischer Erfahrungen ist die Ohnmacht, mit der man ihnen ausgesetzt<br />
ist. Lebewesen sind normalerweise nicht auf Situationen der unausweichlichen<br />
Hilflosigkeit eingerichtet. Dissoziationen sind hier die einzige Möglichkeit aus der Situation zu<br />
entfliehen - wären sie nicht möglich, wäre ein Überleben fraglich.<br />
Überlebende traumatischer Situationen versuchen oftmals, die so erlebte Hilflosigkeit zu<br />
überwinden und wieder Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen. Dies kann geschehen durch<br />
die Übernahme von Schuldgefühlen, die leichter zu ertragen sind als Ohnmacht, oder auch<br />
durch Rachefantasien, die darauf abzielen, die Rollen von Opfer und Täter zu vertauschen.<br />
Das Wiedererlangen von Macht und Kontrolle wird als entscheidend im Verarbeitungsprozess<br />
angesehen. Hierbei kommt dem sozialen Umfeld eine zentrale Rolle zu. Denn das<br />
Wiederherstellen von Sicherheit in der Welt des Traumatisierten findet nicht nur im Behandlungszimmer<br />
des Therapeuten statt, sondern insbesondere auch durch verschiedene<br />
Handlungen im öffentlichen Raum. Hierbei spielt die Anerkennung des Traumas als Unrecht<br />
eine entscheidende Rolle. Gerade wenn es um Traumatisierungen durch politische Gewalt<br />
geht, wurden die Überlebenden nicht selten jahrzehntelang als Kriminelle gesehen, die