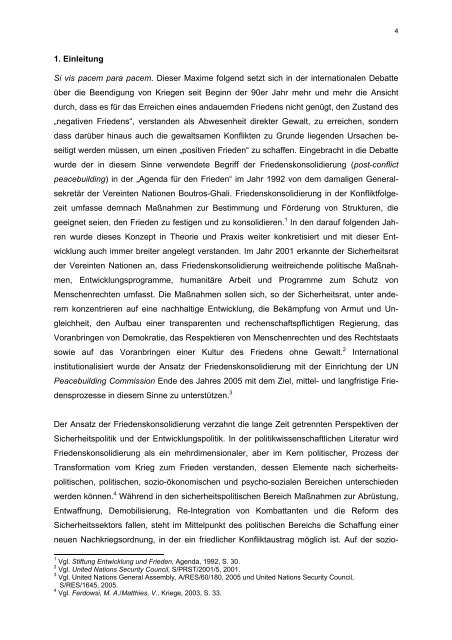"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4<br />
1. Einleitung<br />
Si vis pacem para pacem. Dieser Maxime folgend setzt sich in der internationalen Debatte<br />
über die Beendigung von Kriegen seit Beginn der 90er Jahr mehr und mehr die Ansicht<br />
durch, dass es <strong>für</strong> das Erreichen eines andauernden Friedens nicht genügt, den Zustand des<br />
„negativen Friedens“, verstanden als Abwesenheit direkter Gewalt, zu erreichen, sondern<br />
dass darüber hinaus auch die gewaltsamen Konflikten zu Grunde liegenden Ursachen beseitigt<br />
werden müssen, um einen „positiven Frieden“ zu schaffen. Eingebracht in die Debatte<br />
wurde der in diesem Sinne verwendete Begriff der Friedenskonsolidierung (post-conflict<br />
peacebuilding) in der „Agenda <strong>für</strong> den Frieden“ im Jahr 1992 von dem damaligen Generalsekretär<br />
der Vereinten Nationen Boutros-Ghali. Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit<br />
umfasse demnach Maßnahmen zur Bestimmung und Förderung von Strukturen, die<br />
geeignet seien, den Frieden zu festigen und zu konsolidieren. 1 In den darauf folgenden Jahren<br />
wurde dieses Konzept in Theorie und Praxis weiter konkretisiert und mit dieser Entwicklung<br />
auch immer breiter angelegt verstanden. Im Jahr 2001 erkannte der Sicherheitsrat<br />
der Vereinten Nationen an, dass Friedenskonsolidierung weitreichende politische Maßnahmen,<br />
Entwicklungsprogramme, humanitäre Arbeit und Programme zum Schutz von<br />
Menschenrechten umfasst. Die Maßnahmen sollen sich, so der Sicherheitsrat, unter anderem<br />
konzentrieren auf eine nachhaltige Entwicklung, die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit,<br />
den Aufbau einer transparenten und rechenschaftspflichtigen Regierung, das<br />
Voranbringen von Demokratie, das Respektieren von Menschenrechten und des Rechtstaats<br />
sowie auf das Voranbringen einer Kultur des Friedens ohne Gewalt. 2 International<br />
institutionalisiert wurde der Ansatz der Friedenskonsolidierung mit der Einrichtung der UN<br />
Peacebuilding Commission Ende des Jahres 2005 mit dem Ziel, mittel- und langfristige Friedensprozesse<br />
in diesem Sinne zu unterstützen. 3<br />
Der Ansatz der Friedenskonsolidierung verzahnt die lange Zeit getrennten Perspektiven der<br />
Sicherheitspolitik und der Entwicklungspolitik. In der politikwissenschaftlichen Literatur wird<br />
Friedenskonsolidierung als ein mehrdimensionaler, aber im Kern politischer, Prozess der<br />
Transformation vom Krieg zum Frieden verstanden, dessen Elemente nach sicherheitspolitischen,<br />
politischen, sozio-ökonomischen und psycho-sozialen Bereichen unterschieden<br />
werden können. 4 Während in den sicherheitspolitischen Bereich Maßnahmen zur Abrüstung,<br />
Entwaffnung, Demobilisierung, Re-Integration von Kombattanten und die Reform des<br />
Sicherheitssektors fallen, steht im Mittelpunkt des politischen Bereichs die Schaffung einer<br />
neuen Nachkriegsordnung, in der ein friedlicher Konfliktaustrag möglich ist. Auf der sozio-<br />
1 Vgl. Stiftung Entwicklung und Frieden, Agenda, 1992, S. 30.<br />
2 Vgl. United Nations Security Council, S/PRST/2001/5, 2001.<br />
3 Vgl. United Nations General Assembly, A/RES/60/180, 2005 und United Nations Security Council,<br />
S/RES/1645, 2005.<br />
4 Vgl. Ferdowsi, M. A./Matthies, V., Kriege, 2003, S. 33.