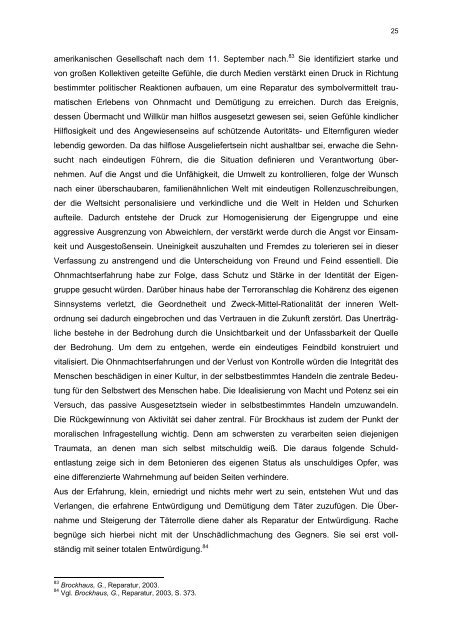"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
25<br />
amerikanischen Gesellschaft nach dem 11. September nach. 83 Sie identifiziert starke und<br />
von großen Kollektiven geteilte Gefühle, die durch Medien verstärkt einen Druck in Richtung<br />
bestimmter politischer Reaktionen aufbauen, um eine Reparatur des symbolvermittelt traumatischen<br />
Erlebens von Ohnmacht und Demütigung zu erreichen. Durch das Ereignis,<br />
dessen Übermacht und Willkür man hilflos ausgesetzt gewesen sei, seien Gefühle kindlicher<br />
Hilflosigkeit und des Angewiesenseins auf schützende Autoritäts- und Elternfiguren wieder<br />
lebendig geworden. Da das hilflose Ausgeliefertsein nicht aushaltbar sei, erwache die Sehnsucht<br />
nach eindeutigen Führern, die die Situation definieren und Verantwortung übernehmen.<br />
Auf die Angst und die Unfähigkeit, die Umwelt zu kontrollieren, folge der Wunsch<br />
nach einer überschaubaren, familienähnlichen Welt mit eindeutigen Rollenzuschreibungen,<br />
der die Weltsicht personalisiere und verkindliche und die Welt in Helden und Schurken<br />
aufteile. Dadurch entstehe der Druck zur Homogenisierung der Eigengruppe und eine<br />
aggressive Ausgrenzung von Abweichlern, der verstärkt werde durch die Angst vor Einsamkeit<br />
und Ausgestoßensein. Uneinigkeit auszuhalten und Fremdes zu tolerieren sei in dieser<br />
Verfassung zu anstrengend und die Unterscheidung von Freund und Feind essentiell. Die<br />
Ohnmachtserfahrung habe zur Folge, dass Schutz und Stärke in der Identität der Eigengruppe<br />
gesucht würden. Darüber hinaus habe der Terroranschlag die Kohärenz des eigenen<br />
Sinnsystems verletzt, die Geordnetheit und Zweck-Mittel-Rationalität der inneren Weltordnung<br />
sei dadurch eingebrochen und das Vertrauen in die Zukunft zerstört. Das Unerträgliche<br />
bestehe in der Bedrohung durch die Unsichtbarkeit und der Unfassbarkeit der Quelle<br />
der Bedrohung. Um dem zu entgehen, werde ein eindeutiges Feindbild konstruiert und<br />
vitalisiert. Die Ohnmachtserfahrungen und der Verlust von Kontrolle würden die Integrität des<br />
Menschen beschädigen in einer Kultur, in der selbstbestimmtes Handeln die zentrale Bedeutung<br />
<strong>für</strong> den Selbstwert des Menschen habe. Die Idealisierung von Macht und Potenz sei ein<br />
Versuch, das passive Ausgesetztsein wieder in selbstbestimmtes Handeln umzuwandeln.<br />
Die Rückgewinnung von Aktivität sei daher zentral. Für Brockhaus ist zudem der Punkt der<br />
moralischen Infragestellung wichtig. Denn am schwersten zu verarbeiten seien diejenigen<br />
Traumata, an denen man sich selbst mitschuldig weiß. Die daraus folgende Schuldentlastung<br />
zeige sich in dem Betonieren des eigenen Status als unschuldiges Opfer, was<br />
eine differenzierte Wahrnehmung auf beiden Seiten verhindere.<br />
Aus der Erfahrung, klein, erniedrigt und nichts mehr wert zu sein, entstehen Wut und das<br />
Verlangen, die erfahrene Entwürdigung und Demütigung dem Täter zuzufügen. Die Übernahme<br />
und Steigerung der Täterrolle diene daher als Reparatur der Entwürdigung. Rache<br />
begnüge sich hierbei nicht mit der Unschädlichmachung des Gegners. Sie sei erst vollständig<br />
mit seiner totalen Entwürdigung. 84<br />
83 Brockhaus, G., Reparatur, 2003.<br />
84 Vgl. Brockhaus, G., Reparatur, 2003, S. 373.