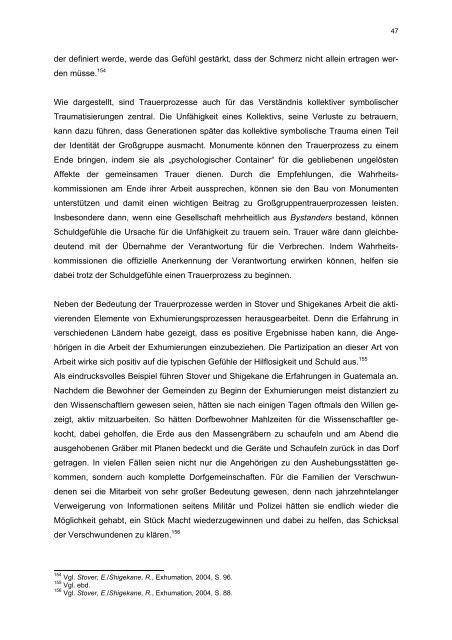"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
47<br />
der definiert werde, werde das Gefühl gestärkt, dass der Schmerz nicht allein ertragen werden<br />
müsse. 154<br />
Wie dargestellt, sind Trauerprozesse auch <strong>für</strong> das Verständnis <strong>kollektiver</strong> symbolischer<br />
Traumatisierungen zentral. Die Unfähigkeit eines Kollektivs, seine Verluste zu betrauern,<br />
kann dazu führen, dass Generationen später das kollektive symbolische Trauma einen Teil<br />
der Identität der Großgruppe ausmacht. Monumente können den Trauerprozess zu einem<br />
Ende bringen, indem sie als „psychologischer Container“ <strong>für</strong> die gebliebenen ungelösten<br />
Affekte der gemeinsamen Trauer dienen. Durch die Empfehlungen, die Wahrheitskommissionen<br />
am Ende ihrer Arbeit aussprechen, können sie den Bau von Monumenten<br />
unterstützen und damit einen wichtigen Beitrag zu Großgruppentrauerprozessen leisten.<br />
Insbesondere dann, wenn eine Gesellschaft mehrheitlich aus Bystanders bestand, können<br />
Schuldgefühle die Ursache <strong>für</strong> die Unfähigkeit zu trauern sein. Trauer wäre dann gleichbedeutend<br />
mit der Übernahme der Verantwortung <strong>für</strong> die Verbrechen. Indem Wahrheitskommissionen<br />
die offizielle Anerkennung der Verantwortung erwirken können, helfen sie<br />
dabei trotz der Schuldgefühle einen Trauerprozess zu beginnen.<br />
Neben der Bedeutung der Trauerprozesse werden in Stover und Shigekanes Arbeit die aktivierenden<br />
Elemente von Exhumierungsprozessen herausgearbeitet. Denn die Erfahrung in<br />
verschiedenen Ländern habe gezeigt, dass es positive Ergebnisse haben kann, die Angehörigen<br />
in die Arbeit der Exhumierungen einzubeziehen. Die Partizipation an dieser Art von<br />
Arbeit wirke sich positiv auf die typischen Gefühle der Hilflosigkeit und Schuld aus. 155<br />
Als eindrucksvolles Beispiel führen Stover und Shigekane die Erfahrungen in Guatemala an.<br />
Nachdem die Bewohner der Gemeinden zu Beginn der Exhumierungen meist distanziert zu<br />
den Wissenschaftlern gewesen seien, hätten sie nach einigen Tagen oftmals den Willen gezeigt,<br />
aktiv mitzuarbeiten. So hätten Dorfbewohner Mahlzeiten <strong>für</strong> die Wissenschaftler gekocht,<br />
dabei geholfen, die Erde aus den Massengräbern zu schaufeln und am Abend die<br />
ausgehobenen Gräber mit Planen bedeckt und die Geräte und Schaufeln zurück in das Dorf<br />
getragen. In vielen Fällen seien nicht nur die Angehörigen zu den Aushebungsstätten gekommen,<br />
sondern auch komplette Dorfgemeinschaften. Für die Familien der Verschwundenen<br />
sei die Mitarbeit von sehr großer Bedeutung gewesen, denn nach jahrzehntelanger<br />
Verweigerung von Informationen seitens Militär und Polizei hätten sie endlich wieder die<br />
Möglichkeit gehabt, ein Stück Macht wiederzugewinnen und dabei zu helfen, das Schicksal<br />
der Verschwundenen zu klären. 156<br />
154 Vgl. Stover, E./Shigekane, R., Exhumation, 2004, S. 96.<br />
155 Vgl. ebd.<br />
156 Vgl. Stover, E./Shigekane, R., Exhumation, 2004, S. 88.