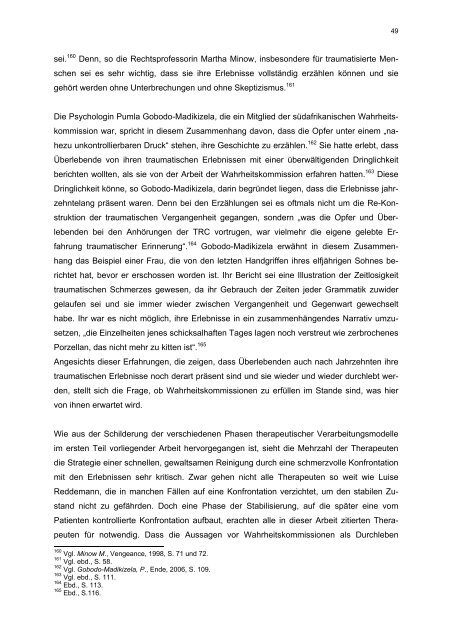"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
49<br />
sei. 160 Denn, so die Rechtsprofessorin Martha Minow, insbesondere <strong>für</strong> traumatisierte Menschen<br />
sei es sehr wichtig, dass sie ihre Erlebnisse vollständig erzählen können und sie<br />
gehört werden ohne Unterbrechungen und ohne Skeptizismus. 161<br />
Die Psychologin Pumla Gobodo-Madikizela, die ein Mitglied der südafrikanischen Wahrheitskommission<br />
war, spricht in diesem Zusammenhang davon, dass die Opfer unter einem „nahezu<br />
unkontrollierbaren Druck“ stehen, ihre Geschichte zu erzählen. 162 Sie hatte erlebt, dass<br />
Überlebende von ihren traumatischen Erlebnissen mit einer überwältigenden Dringlichkeit<br />
berichten wollten, als sie von der Arbeit der Wahrheitskommission erfahren hatten. 163 Diese<br />
Dringlichkeit könne, so Gobodo-Madikizela, darin begründet liegen, dass die Erlebnisse jahrzehntelang<br />
präsent waren. Denn bei den Erzählungen sei es oftmals nicht um die Re-Konstruktion<br />
der traumatischen Vergangenheit gegangen, sondern „was die Opfer und Überlebenden<br />
bei den Anhörungen der TRC vortrugen, war vielmehr die eigene gelebte Erfahrung<br />
traumatischer Erinnerung“. 164 Gobodo-Madikizela erwähnt in diesem Zusammenhang<br />
das Beispiel einer Frau, die von den letzten Handgriffen ihres elfjährigen Sohnes berichtet<br />
hat, bevor er erschossen worden ist. Ihr Bericht sei eine Illustration der Zeitlosigkeit<br />
traumatischen Schmerzes gewesen, da ihr Gebrauch der Zeiten jeder Grammatik zuwider<br />
gelaufen sei und sie immer wieder zwischen Vergangenheit und Gegenwart gewechselt<br />
habe. Ihr war es nicht möglich, ihre Erlebnisse in ein zusammenhängendes Narrativ umzusetzen,<br />
„die Einzelheiten jenes schicksalhaften Tages lagen noch verstreut wie zerbrochenes<br />
Porzellan, das nicht mehr zu kitten ist“. 165<br />
Angesichts dieser Erfahrungen, die zeigen, dass Überlebenden auch nach Jahrzehnten ihre<br />
traumatischen Erlebnisse noch derart präsent sind und sie wieder und wieder durchlebt werden,<br />
stellt sich die Frage, ob Wahrheitskommissionen zu erfüllen im Stande sind, was hier<br />
von ihnen erwartet wird.<br />
Wie aus der Schilderung der verschiedenen Phasen therapeutischer Verarbeitungsmodelle<br />
im ersten Teil vorliegender Arbeit hervorgegangen ist, sieht die Mehrzahl der Therapeuten<br />
die Strategie einer schnellen, gewaltsamen Reinigung durch eine schmerzvolle Konfrontation<br />
mit den Erlebnissen sehr kritisch. Zwar gehen nicht alle Therapeuten so weit wie Luise<br />
Reddemann, die in manchen Fällen auf eine Konfrontation verzichtet, um den stabilen Zustand<br />
nicht zu gefährden. Doch eine Phase der Stabilisierung, auf die später eine vom<br />
Patienten kontrollierte Konfrontation aufbaut, erachten alle in dieser Arbeit zitierten Therapeuten<br />
<strong>für</strong> notwendig. Dass die Aussagen vor Wahrheitskommissionen als Durchleben<br />
160 Vgl. Minow M., Vengeance, 1998, S. 71 und 72.<br />
161 Vgl. ebd., S. 58.<br />
162 Vgl. Gobodo-Madikizela, P., Ende, 2006, S. 109.<br />
163 Vgl. ebd., S. 111.<br />
164 Ebd., S. 113.<br />
165 Ebd., S.116.