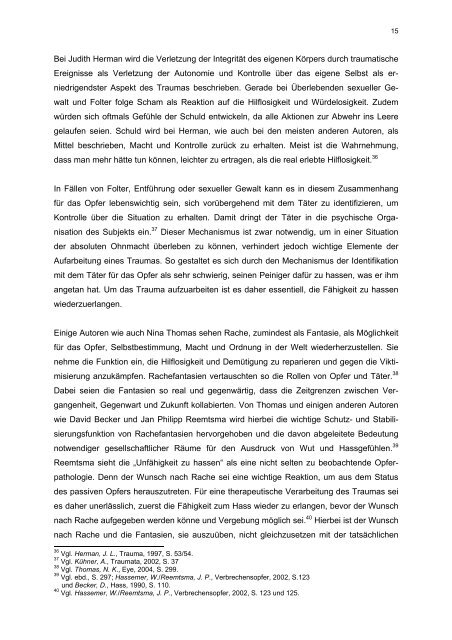"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
"kollektiver Traumata" (Nr. 48) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
15<br />
Bei Judith Herman wird die Verletzung der Integrität des eigenen Körpers durch traumatische<br />
Ereignisse als Verletzung der Autonomie und Kontrolle über das eigene Selbst als erniedrigendster<br />
Aspekt des Traumas beschrieben. Gerade bei Überlebenden sexueller Gewalt<br />
und Folter folge Scham als Reaktion auf die Hilflosigkeit und Würdelosigkeit. Zudem<br />
würden sich oftmals Gefühle der Schuld entwickeln, da alle Aktionen zur Abwehr ins Leere<br />
gelaufen seien. Schuld wird bei Herman, wie auch bei den meisten anderen Autoren, als<br />
Mittel beschrieben, Macht und Kontrolle zurück zu erhalten. Meist ist die Wahrnehmung,<br />
dass man mehr hätte tun können, leichter zu ertragen, als die real erlebte Hilflosigkeit. 36<br />
In Fällen von Folter, Entführung oder sexueller Gewalt kann es in diesem Zusammenhang<br />
<strong>für</strong> das Opfer lebenswichtig sein, sich vorübergehend mit dem Täter zu identifizieren, um<br />
Kontrolle über die Situation zu erhalten. Damit dringt der Täter in die psychische Organisation<br />
des Subjekts ein. 37 Dieser Mechanismus ist zwar notwendig, um in einer Situation<br />
der absoluten Ohnmacht überleben zu können, verhindert jedoch wichtige Elemente der<br />
Aufarbeitung eines Traumas. So gestaltet es sich durch den Mechanismus der Identifikation<br />
mit dem Täter <strong>für</strong> das Opfer als sehr schwierig, seinen Peiniger da<strong>für</strong> zu hassen, was er ihm<br />
angetan hat. Um das Trauma aufzuarbeiten ist es daher essentiell, die Fähigkeit zu hassen<br />
wiederzuerlangen.<br />
Einige Autoren wie auch Nina Thomas sehen Rache, zumindest als Fantasie, als Möglichkeit<br />
<strong>für</strong> das Opfer, Selbstbestimmung, Macht und Ordnung in der Welt wiederherzustellen. Sie<br />
nehme die Funktion ein, die Hilflosigkeit und Demütigung zu reparieren und gegen die Viktimisierung<br />
anzukämpfen. Rachefantasien vertauschten so die Rollen von Opfer und Täter. 38<br />
Dabei seien die Fantasien so real und gegenwärtig, dass die Zeitgrenzen zwischen Vergangenheit,<br />
Gegenwart und Zukunft kollabierten. Von Thomas und einigen anderen Autoren<br />
wie David Becker und Jan Philipp Reemtsma wird hierbei die wichtige Schutz- und Stabilisierungsfunktion<br />
von Rachefantasien hervorgehoben und die davon abgeleitete Bedeutung<br />
notwendiger gesellschaftlicher Räume <strong>für</strong> den Ausdruck von Wut und Hassgefühlen. 39<br />
Reemtsma sieht die „Unfähigkeit zu hassen“ als eine nicht selten zu beobachtende Opferpathologie.<br />
Denn der Wunsch nach Rache sei eine wichtige Reaktion, um aus dem Status<br />
des passiven Opfers herauszutreten. Für eine therapeutische Verarbeitung des Traumas sei<br />
es daher unerlässlich, zuerst die Fähigkeit zum Hass wieder zu erlangen, bevor der Wunsch<br />
nach Rache aufgegeben werden könne und Vergebung möglich sei. 40 Hierbei ist der Wunsch<br />
nach Rache und die Fantasien, sie auszuüben, nicht gleichzusetzen mit der tatsächlichen<br />
36 Vgl. Herman, J. L., Trauma, 1997, S. 53/54.<br />
37 Vgl. Kühner, A., Traumata, 2002, S. 37<br />
38 Vgl. Thomas, N. K., Eye, 2004, S. 299.<br />
39 Vgl. ebd., S. 297; Hassemer, W./Reemtsma, J. P., Verbrechensopfer, 2002, S.123<br />
und Becker, D., Hass, 1990, S. 110.<br />
40 Vgl. Hassemer, W./Reemtsma, J. P., Verbrechensopfer, 2002, S. 123 und 125.