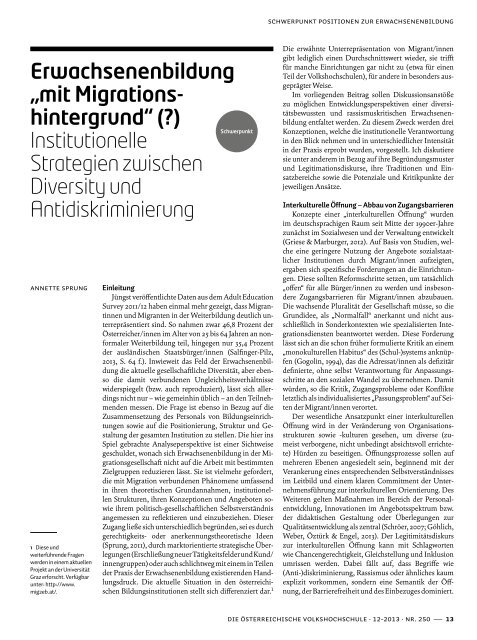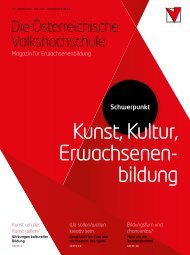zur Erwachsenenbildung
zur Erwachsenenbildung
zur Erwachsenenbildung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schwerpunkt Positionen <strong>zur</strong> <strong>Erwachsenenbildung</strong><br />
<strong>Erwachsenenbildung</strong><br />
„mit Migrationshintergrund“<br />
(?)<br />
Institutionelle<br />
Strategien zwischen<br />
Diversity und<br />
Antidiskriminierung<br />
Annette Sprung<br />
1 Diese und<br />
weiterführende Fragen<br />
werden in einem aktuellen<br />
Projekt an der Universität<br />
Graz erforscht. Verfügbar<br />
unter: http://www.<br />
mig2eb.at/.<br />
Schwerpunkt<br />
Einleitung<br />
Jüngst veröffentlichte Daten aus dem Adult Education<br />
Survey 2011/12 haben einmal mehr gezeigt, dass Migrantinnen<br />
und Migranten in der Weiterbildung deutlich unterrepräsentiert<br />
sind. So nahmen zwar 46,8 Prozent der<br />
Österreicher/innen im Alter von 25 bis 64 Jahren an nonformaler<br />
Weiterbildung teil, hingegen nur 35,4 Prozent<br />
der ausländischen Staatsbürger/innen (Salfinger-Pilz,<br />
2013, S. 64 f.). Inwieweit das Feld der <strong>Erwachsenenbildung</strong><br />
die aktuelle gesellschaftliche Diversität, aber ebenso<br />
die damit verbundenen Ungleichheitsverhältnisse<br />
widerspiegelt (bzw. auch reproduziert), lässt sich allerdings<br />
nicht nur – wie gemeinhin üblich – an den Teilnehmenden<br />
messen. Die Frage ist ebenso in Bezug auf die<br />
Zusammensetzung des Personals von Bildungseinrichtungen<br />
sowie auf die Positionierung, Struktur und Gestaltung<br />
der gesamten Institution zu stellen. Die hier ins<br />
Spiel gebrachte Analyseperspektive ist einer Sichtweise<br />
geschuldet, wonach sich <strong>Erwachsenenbildung</strong> in der Migrationsgesellschaft<br />
nicht auf die Arbeit mit bestimmten<br />
Zielgruppen reduzieren lässt. Sie ist vielmehr gefordert,<br />
die mit Migration verbundenen Phänomene umfassend<br />
in ihren theoretischen Grundannahmen, institutionellen<br />
Strukturen, ihren Konzeptionen und Angeboten sowie<br />
ihrem politisch-gesellschaftlichen Selbstverständnis<br />
angemessen zu reflektieren und einzubeziehen. Dieser<br />
Zugang ließe sich unterschiedlich begründen, sei es durch<br />
gerechtigkeits- oder anerkennungstheoretische Ideen<br />
(Sprung, 2011), durch marktorientierte strategische Überlegungen<br />
(Erschließung neuer Tätigkeitsfelder und Kund/<br />
innengruppen) oder auch schlichtweg mit einem in Teilen<br />
der Praxis der <strong>Erwachsenenbildung</strong> existierenden Handlungsdruck.<br />
Die aktuelle Situation in den österreichischen<br />
Bildungsinstitutionen stellt sich differenziert dar. 1<br />
Die erwähnte Unterrepräsentation von Migrant/innen<br />
gibt lediglich einen Durchschnittswert wieder, sie trifft<br />
für manche Einrichtungen gar nicht zu (etwa für einen<br />
Teil der Volkshochschulen), für andere in besonders ausgeprägter<br />
Weise.<br />
Im vorliegenden Beitrag sollen Diskussionsanstöße<br />
zu möglichen Entwicklungsperspektiven einer diversitätsbewussten<br />
und rassismuskritischen <strong>Erwachsenenbildung</strong><br />
entfaltet werden. Zu diesem Zweck werden drei<br />
Konzeptionen, welche die institutionelle Verantwortung<br />
in den Blick nehmen und in unterschiedlicher Intensität<br />
in der Praxis erprobt wurden, vorgestellt. Ich diskutiere<br />
sie unter anderem in Bezug auf ihre Begründungsmuster<br />
und Legitimationsdiskurse, ihre Traditionen und Einsatzbereiche<br />
sowie die Potenziale und Kritikpunkte der<br />
jeweiligen Ansätze.<br />
Interkulturelle Öffnung – Abbau von Zugangsbarrieren<br />
Konzepte einer „interkulturellen Öffnung“ wurden<br />
im deutschsprachigen Raum seit Mitte der 1990er-Jahre<br />
zunächst im Sozialwesen und der Verwaltung entwickelt<br />
(Griese & Marburger, 2012). Auf Basis von Studien, welche<br />
eine geringere Nutzung der Angebote sozialstaatlicher<br />
Institutionen durch Migrant/innen aufzeigten,<br />
ergaben sich spezifische Forderungen an die Einrichtungen.<br />
Diese sollten Reformschritte setzen, um tatsächlich<br />
„offen“ für alle Bürger/innen zu werden und insbesondere<br />
Zugangsbarrieren für Migrant/innen abzubauen.<br />
Die wachsende Pluralität der Gesellschaft müsse, so die<br />
Grundidee, als „Normalfall“ anerkannt und nicht ausschließlich<br />
in Sonderkontexten wie spezialisierten Integrationsdiensten<br />
beantwortet werden. Diese Forderung<br />
lässt sich an die schon früher formulierte Kritik an einem<br />
„monokulturellen Habitus“ des (Schul-)systems anknüpfen<br />
(Gogolin, 1994), das die Adressat/innen als defizitär<br />
definierte, ohne selbst Verantwortung für Anpassungsschritte<br />
an den sozialen Wandel zu übernehmen. Damit<br />
würden, so die Kritik, Zugangsprobleme oder Konflikte<br />
letztlich als individualisiertes „Passungsproblem“ auf Seiten<br />
der Migrant/innen verortet.<br />
Der wesentliche Ansatzpunkt einer interkulturellen<br />
Öffnung wird in der Veränderung von Organisationsstrukturen<br />
sowie -kulturen gesehen, um diverse (zumeist<br />
verborgene, nicht unbedingt absichtsvoll errichtete)<br />
Hürden zu beseitigen. Öffnungsprozesse sollen auf<br />
mehreren Ebenen angesiedelt sein, beginnend mit der<br />
Verankerung eines entsprechenden Selbstverständnisses<br />
im Leitbild und einem klaren Commitment der Unternehmensführung<br />
<strong>zur</strong> interkulturellen Orientierung. Des<br />
Weiteren gelten Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung,<br />
Innovationen im Angebotsspektrum bzw.<br />
der didaktischen Gestaltung oder Überlegungen <strong>zur</strong><br />
Qualitätsentwicklung als zentral (Schröer, 2007; Göhlich,<br />
Weber, Öztürk & Engel, 2013). Der Legitimitätsdiskurs<br />
<strong>zur</strong> interkulturellen Öffnung kann mit Schlagworten<br />
wie Chancengerechtigkeit, Gleichstellung und Inklusion<br />
umrissen werden. Dabei fällt auf, dass Begriffe wie<br />
(Anti-)diskriminierung, Rassismus oder ähnliches kaum<br />
explizit vorkommen, sondern eine Semantik der Öffnung,<br />
der Barrierefreiheit und des Einbezuges dominiert.<br />
DIE ÖSTERREICHISCHE VOLKSHOCHSCHULE · 12-2013 · NR. 250 — 13