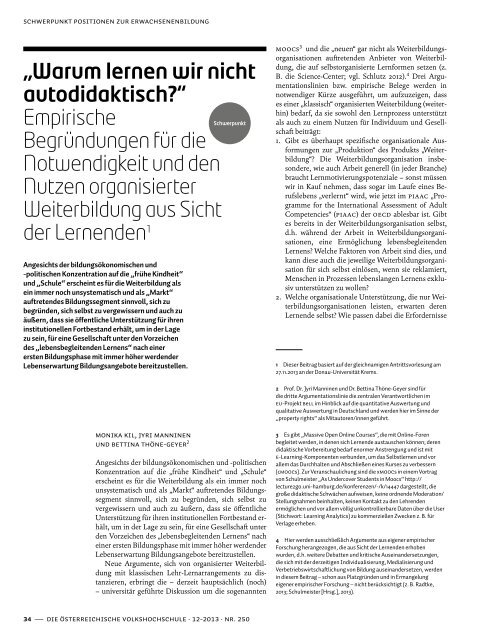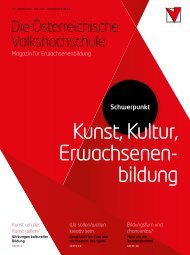zur Erwachsenenbildung
zur Erwachsenenbildung
zur Erwachsenenbildung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schwerpunkt Positionen <strong>zur</strong> <strong>Erwachsenenbildung</strong><br />
„Warum lernen wir nicht<br />
autodidaktisch?“<br />
Empirische<br />
Schwerpunkt<br />
Begründungen für die<br />
Notwendigkeit und den<br />
Nutzen organisierter<br />
Weiterbildung aus Sicht<br />
der Lernenden 1<br />
Angesichts der bildungsökonomischen und<br />
-politischen Konzentration auf die „frühe Kindheit“<br />
und „Schule“ erscheint es für die Weiterbildung als<br />
ein immer noch unsystematisch und als „Markt“<br />
auftretendes Bildungssegment sinnvoll, sich zu<br />
begründen, sich selbst zu vergewissern und auch zu<br />
äußern, dass sie öffentliche Unterstützung für ihren<br />
institutionellen Fortbestand erhält, um in der Lage<br />
zu sein, für eine Gesellschaft unter den Vorzeichen<br />
des „lebensbegleitenden Lernens“ nach einer<br />
ersten Bildungsphase mit immer höher werdender<br />
Lebenserwartung Bildungsangebote bereitzustellen.<br />
moocs 3 und die „neuen“ gar nicht als Weiterbildungsorganisationen<br />
auftretenden Anbieter von Weiterbildung,<br />
die auf selbstorganisierte Lernformen setzen (z.<br />
B. die Science-Center; vgl. Schlutz 2012). 4 Drei Argumentationslinien<br />
bzw. empirische Belege werden in<br />
notwendiger Kürze ausgeführt, um aufzuzeigen, dass<br />
es einer „klassisch“ organisierten Weiterbildung (weiterhin)<br />
bedarf, da sie sowohl den Lernprozess unterstützt<br />
als auch zu einem Nutzen für Individuum und Gesellschaft<br />
beiträgt:<br />
1. Gibt es überhaupt spezifische organisationale Ausformungen<br />
<strong>zur</strong> „Produktion“ des Produkts „Weiterbildung“?<br />
Die Weiterbildungsorganisation insbesondere,<br />
wie auch Arbeit generell (in jeder Branche)<br />
braucht Lernmotivierungspotenziale – sonst müssen<br />
wir in Kauf nehmen, dass sogar im Laufe eines Berufslebens<br />
„verlernt“ wird, wie jetzt im piaac „Programme<br />
for the International Assessment of Adult<br />
Competencies“ (piaac) der oecd ablesbar ist. Gibt<br />
es bereits in der Weiterbildungsorganisation selbst,<br />
d.h. während der Arbeit in Weiterbildungsorganisationen,<br />
eine Ermöglichung lebensbegleitenden<br />
Lernens? Welche Faktoren von Arbeit sind dies, und<br />
kann diese auch die jeweilige Weiterbildungsorganisation<br />
für sich selbst einlösen, wenn sie reklamiert,<br />
Menschen in Prozessen lebenslangen Lernens exklusiv<br />
unterstützen zu wollen?<br />
2. Welche organisationale Unterstützung, die nur Weiterbildungsorganisationen<br />
leisten, erwarten deren<br />
Lernende selbst? Wie passen dabei die Erfordernisse<br />
1 Dieser Beitrag basiert auf der gleichnamigen Antrittsvorlesung am<br />
27.11.2013 an der Donau-Universität Krems.<br />
2 Prof. Dr. Jyri Manninen und Dr. Bettina Thöne-Geyer sind für<br />
die dritte Argumentationslinie die zentralen Verantwortlichen im<br />
EU-Projekt BeLL im Hinblick auf die quantitative Auswertung und<br />
qualitative Auswertung in Deutschland und werden hier im Sinne der<br />
„property rights“ als Mitautoren/innen geführt.<br />
Monika Kil, Jyri Manninen<br />
und Bettina Thöne-Geyer 2<br />
Angesichts der bildungsökonomischen und -politischen<br />
Konzentration auf die „frühe Kindheit“ und „Schule“<br />
erscheint es für die Weiterbildung als ein immer noch<br />
unsystematisch und als „Markt“ auftretendes Bildungssegment<br />
sinnvoll, sich zu begründen, sich selbst zu<br />
vergewissern und auch zu äußern, dass sie öffentliche<br />
Unterstützung für ihren institutionellen Fortbestand erhält,<br />
um in der Lage zu sein, für eine Gesellschaft unter<br />
den Vorzeichen des „lebensbegleitenden Lernens“ nach<br />
einer ersten Bildungsphase mit immer höher werdender<br />
Lebenserwartung Bildungsangebote bereitzustellen.<br />
Neue Argumente, sich von organisierter Weiterbildung<br />
mit klassischen Lehr-Lernarrangements zu distanzieren,<br />
erbringt die – derzeit hauptsächlich (noch)<br />
– universitär geführte Diskussion um die sogenannten<br />
3 Es gibt „Massive Open Online Courses“, die mit Online-Foren<br />
begleitet werden, in denen sich Lernende austauschen können; deren<br />
didaktische Vorbereitung bedarf enormer Anstrengung und ist mit<br />
E-Learning-Komponenten verbunden, um das Selbstlernen und vor<br />
allem das Durchhalten und Abschließen eines Kurses zu verbessern<br />
(cMOOCs). Zur Veranschaulichung sind die xMOOCs in einem Vortrag<br />
von Schulmeister „As Undercover Students in Moocs“ http://<br />
lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/14447 dargestellt, die<br />
große didaktische Schwächen aufweisen, keine ordnende Moderation/<br />
Stellungnahmen beinhalten, keinen Kontakt zu den Lehrenden<br />
ermöglichen und vor allem völlig unkontrollierbare Daten über die User<br />
(Stichwort: Learning Analytics) zu kommerziellen Zwecken z. B. für<br />
Verlage erheben.<br />
4 Hier werden ausschließlich Argumente aus eigener empirischer<br />
Forschung herangezogen, die aus Sicht der Lernenden erhoben<br />
wurden, d.h. weitere Debatten und kritische Auseinandersetzungen,<br />
die sich mit der derzeitigen Individualisierung, Medialisierung und<br />
Verbetriebswirtschaftlichung von Bildung auseinandersetzen, werden<br />
in diesem Beitrag – schon aus Platzgründen und in Ermangelung<br />
eigener empirischer Forschung – nicht berücksichtigt (z. B. Radtke,<br />
2013; Schulmeister [Hrsg.], 2013).<br />
34 — DIE ÖSTERREICHISCHE VOLKSHOCHSCHULE · 12-2013 · NR. 250