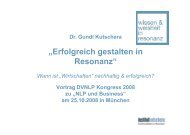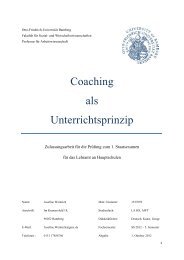Theorie Sozialkompetenz in der Resonanzmethode - Institut Kutschera
Theorie Sozialkompetenz in der Resonanzmethode - Institut Kutschera
Theorie Sozialkompetenz in der Resonanzmethode - Institut Kutschera
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Verb<strong>in</strong>dung zu treten, dabei werden jeweils die präferiert, die <strong>in</strong> immer wie<strong>der</strong>kehrenden<br />
Interaktionsmustern auftreten, als Interaktionsmuster zu Beziehungsregeln werden und so<br />
e<strong>in</strong> begrenztes Beziehungsgeflecht für e<strong>in</strong>en bestimmten Zeitraum konstituieren. Soziale<br />
Systeme lassen sich wie<strong>der</strong>um <strong>in</strong> Teilsysteme unterglie<strong>der</strong>n und differenzieren. Mit Hilfe<br />
verschiedener sozialer Medien werden ganz allgeme<strong>in</strong> "Energien" und "S<strong>in</strong>n" <strong>in</strong> Form von<br />
sozialem Handeln und Kommunikation ausgetauscht.<br />
E<strong>in</strong> System benötigt Grenzen, ke<strong>in</strong> System kann außerhalb se<strong>in</strong>er Grenzen operieren . Die<br />
Systemgrenze ist allgeme<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Kriterium, welches erlaubt zu unterscheiden, was Teil des<br />
Systems ist, so dass zur Systemumgebung alles zählt, was nicht.“ (vgl. Beushausen, 2002:<br />
38)<br />
3.2.5 Kybernetische Grundlagen<br />
Als Kybernetik wird die Wissenschaft bezeichnet, die sich damit beschäftigt<br />
selbstregulierende Systeme und <strong>der</strong>en Prozesse zu beobachten und erforschen.<br />
Systemische und kybernetische Erkenntnisse gehen davon aus, dass <strong>der</strong> Mensch e<strong>in</strong> Teil<br />
und e<strong>in</strong> Ganzes von verschiedenen autopoietischen Systemen ist. Ludwig VON<br />
BERTALANFFY def<strong>in</strong>iert Systeme „als die Gesamtheit <strong>der</strong> wechselseitigen Relationen<br />
zwischen Elementen e<strong>in</strong>er Ganzheit.“ (Richter, 1997: 112) Das besagt wie<strong>der</strong>um, dass es<br />
Grenzen zwischen Systemen und zwischen <strong>in</strong>nerhalb und außerhalb e<strong>in</strong>es Systems geben<br />
muss.<br />
Die Beziehung <strong>der</strong> Elemente <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em System ist immer wechselseitig. Kybernetik setzt<br />
weiters voraus, dass wir nicht alle<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d auf <strong>der</strong> Welt und unsere Denkstrukturen und<br />
Handlungen Auswirkungen auf unser Umfeld haben können.<br />
Virg<strong>in</strong>ia Satir geht <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne davon aus, dass wenn sich e<strong>in</strong> Teil im System Familie<br />
verän<strong>der</strong>t, verän<strong>der</strong>t sich das gesamte System.<br />
Diese neue Intersubjektivität und das Entdecken möglichst vieler Handlungsspielräume<br />
gehen davon aus, dass es nicht nur e<strong>in</strong>e „logische“ Reaktion bei e<strong>in</strong>er bestimmten Aktion<br />
gibt, son<strong>der</strong>n, dass es e<strong>in</strong>e Vielzahl von möglichen Reaktionen gibt.<br />
3.2.5.1 Triviale und Nicht-Triviale Systeme<br />
Kybernetik geht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Beschreibung <strong>der</strong> Wirklichkeit (Kybernetik 1. Ordnung) noch e<strong>in</strong>en<br />
Schritt weiter und beschäftigt sich mit <strong>der</strong> Beschreibung <strong>der</strong> Beobachter dieser Wirklichkeit<br />
(Kybernetik 2. Ordnung) und <strong>der</strong> Beobachtung <strong>der</strong> Beobachter (Kybernetik 3. Ordnung).<br />
Zwischen den AkteurInnen und BeobachterInnen <strong>der</strong> Gesellschaft laufen sogenannte<br />
Feedbackschleifen, die aus möglichen Aktionen e<strong>in</strong>e Vielfalt an möglichen Reaktionen<br />
hervorrufen. He<strong>in</strong>z VON FOERSTER erforschte <strong>in</strong> diesem Zusammenhang die<br />
Beschaffenheit von trivialen Masch<strong>in</strong>en (logische Input – Output Mechanismen) und nichttriviale<br />
Masch<strong>in</strong>en. Er hielt das Streben <strong>der</strong> Gesellschaft nach Trivialisierung, also nach<br />
möglichst e<strong>in</strong>fach gestrickten Erklärungsmechanismen für höchst gefährlich, da es den<br />
e<strong>in</strong>zelnen Menschen entmündigt.<br />
Lebende Systeme müssen sich selbst immer aufrecht erhalten, sie entwickeln<br />
systemeigenen Dynamiken, die manchmal für Systemexterne Faktoren nicht leicht o<strong>der</strong> gar<br />
nicht erkennbar s<strong>in</strong>d. Durch diese Dynamik und das dadurch laufende Lernen von Systemen<br />
<strong>Theorie</strong> OÖ_ 1/281008 www.kutschera.org S26/113